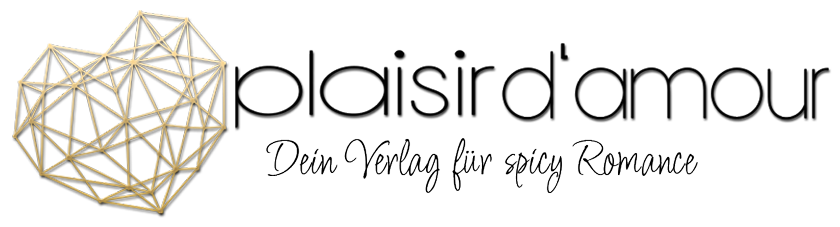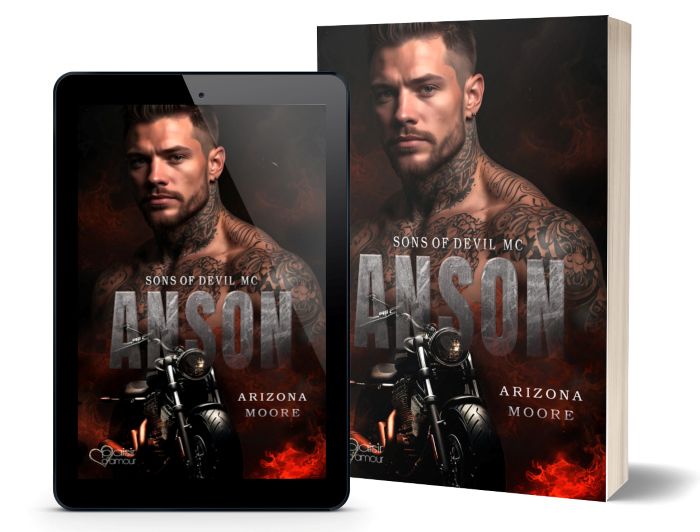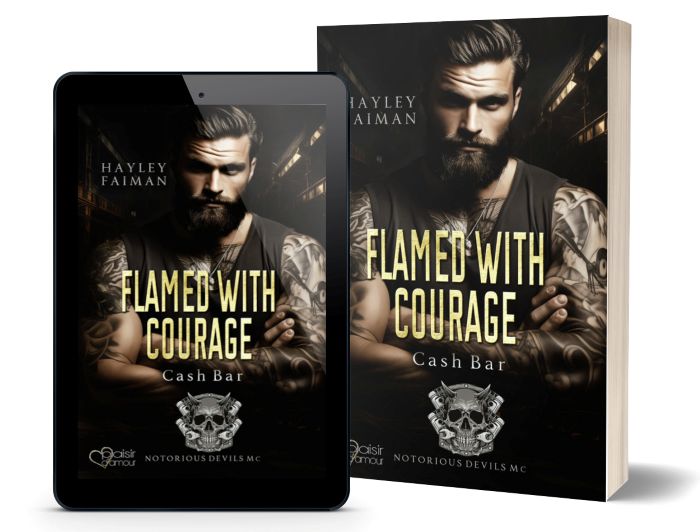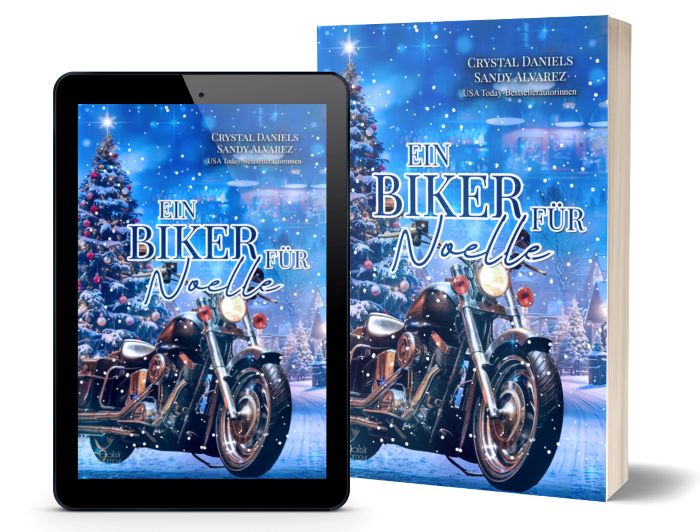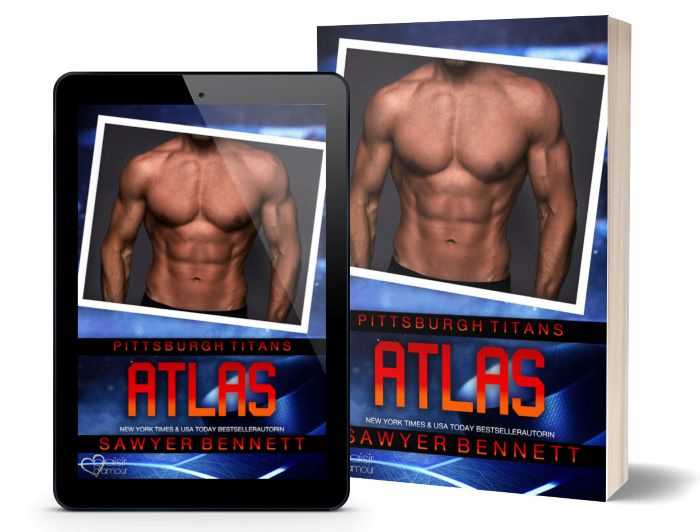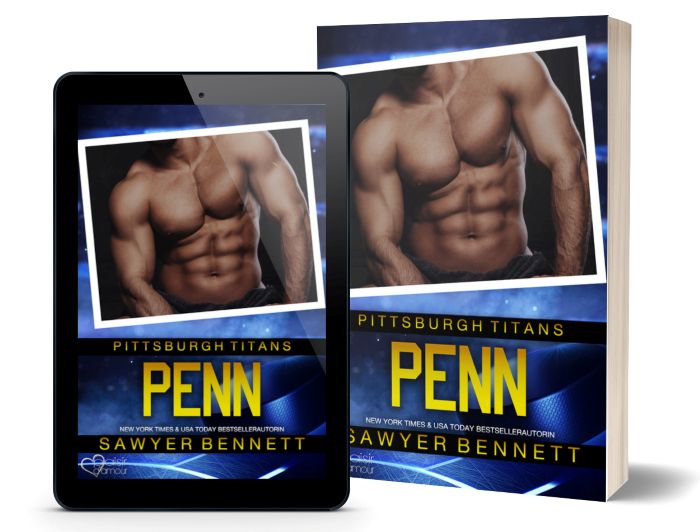Inhaltsangabe
Brooklyn Heart hat ihr ganzes Leben hinter Klostermauern verbracht – in einer Welt aus Stille, Gebeten und Gehorsam. Von Freiheit, Verlangen und Gefahr hat sie keine Ahnung … bis sie einem Mann begegnet, der all das verkörpert, wovor sie ihr Glaube immer gewarnt hat.
Als Brooklyn eines Abends von einer Gruppe Männer bedroht wird, taucht er auf: Anson Summers – tätowiert, gefährlich und sündig attraktiv. Ein Mitglied der Sons of Devil, eines Motorradclubs, der für Chaos, Macht und Versuchung steht.
Als nach Brooklyns Rettung klar wird, dass ihr Angreifer Verbindungen zum Club hat, bekommt Anson den undankbaren Auftrag, sie zu beschützen – Tag und Nacht. Keiner der beiden ist begeistert, denn zwei Welten prallen aufeinander: Unschuld trifft auf Sünde, Disziplin auf pure Begierde.
Inmitten der ständigen Gefahr, die Brooklyn umgibt, brennt die Luft zwischen ihnen heißer als jede Hölle. Doch ohne es zu wissen, trägt sie ein Geheimnis in sich, das nicht nur ihr Schicksal besiegelt – sondern den Sons of Devil MC in den Untergang treiben könnte.
Und am Ende bleibt nur eine Frage: Wie viel Risiko ist Liebe wert, wenn sie alles zerstören kann?
Leseprobe
Anson
Kaum dass ich an seine Tür geklopft habe, vernehme ich ein knappes Herein und trete ein. Cole sitzt hinter seinem Schreibtisch. Er ist ein Hüne von einem Mann, mit breiten Schultern und einem finsteren Blick. Heute wirkt er noch grimmiger als sonst.
„Prez“, begrüße ich ihn und nehme auf einem Stuhl vor seinem Tisch Platz.
„Ich habe mit Lucy gesprochen“, teilt er mir ohne Umschweife mit.
Ich lehne mich zurück. „Das heißt?“
Cole atmet schwer ein. „Brooklyn wurde als Baby bei den Nonnen abgegeben. Man hat sie in eine Decke eingewickelt vor den Toren der Basilika abgelegt. Wer ihre Eltern sind, wissen die Schwestern nicht. Alles, was ihnen klar ist, ist, dass ihre Mom aus Angst vor dem Vater des Kindes Brooklyn dort hingebracht hat.“
Meine Muskeln spannen sich an.
„In einem Rucksack befand sich ein Brief. In diesem bat die Mutter um Schutz für ihr Kind. Sie flehte darum, dass die Schwestern niemandem von Brooklyns Existenz erzählen, da die Kleine das ihr Leben kosten könnte“, fährt Cole fort.
Ich lasse seine Worte in meinem Kopf nachhallen. Brooklyn wurde also versteckt, weil ihre Mom Angst hatte. Aber vor wem? Wer ist ihr Erzeuger?
„Hat diese Lucy noch mehr gesagt?“
Cole nickt. „Die Nonnen haben recherchiert. Brooklyn ist in einer Klinik hier in Chicago zur Welt gekommen. Die Mutter hat sie unter falschem Namen entbunden, aber eine Krankenschwester konnte sich noch an die Frau erinnern. Jung, völlig verängstigt, von blauen Flecken übersät. Ehe das Krankenhaus die Polizei einschalten konnte, waren sie und das Baby verschwunden.“
Mein Kiefer spannt sich an. „Und der Vater?“
„Unbekannt“, entgegnet Cole. „Irgendwer wollte nicht, dass Brooklyn lebt. Und wenn dieser jemand noch am Leben ist und herausfindet, wo sie ist, dann …“
Er braucht den Satz nicht zu beenden.
Ich fahre mir mit einer Hand durch die Haare. Brooklyn hat nicht den Hauch einer Ahnung, in welcher Gefahr sie schwebt.
„Deswegen ist es umso wichtiger, dass Brooklyn nicht zu den Bullen rennt. Nicht nur wegen des Clubs, sondern auch wegen ihrer eigenen Sicherheit. Wird sie dort aktenkundig, könnte es sein, dass ihr Erzeuger auf sie aufmerksam wird“, meint Cole. „Wir wissen zwar nicht, wer er ist, aber ich gehe davon aus, dass er keiner von den Guten ist. Dass er, wie wir, auf der dunklen Seite des Lebens wandelt.“
Scheiße, das ändert die Ausgangslage massiv. Sie darf unter keinen Umständen mit der Polizei sprechen – keine Chance. Den Club mal kurz ausgeklammert, würde sie sich damit in Gefahr bringen. Vermutlich in eine tödliche Gefahr.
Cole beugt sich vor und verschränkt die Arme auf seinem Schreibtisch. „Ich habe mit Lucy besprochen, dass Brooklyn vorerst bei uns bleibt. Wir müssen alles daran setzen, sie davon zu überzeugen, von einer Anzeige abzusehen. Außerdem sollten wir herausfinden, wer ihr Dad ist. Die Äbtissin hat dem zugestimmt. Wenn auch nur unter Protest. Sobald wir uns absolut sicher sein können, dass sie für sich und den Club keine Gefahr darstellt, können wir sie gehen lassen.“
„Und wie willst du das sicherstellen?“, hake ich nach. „Man kann einem Menschen nicht in den Kopf gucken. Sie erzählen einem viele Dinge, wenn der Tag lang ist. Wir können nicht kontrollieren, was sie tut.“
Cole fährt sich genervt mit der Hand durch die Haare. Sein Blick ist hart, aber ich sehe die Unsicherheit dahinter. „Als ob ich das nicht selbst wüsste“, donnert er. „Keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Ihr Vertrauen gewinnen? Sie gefügig machen? Was weiß ich.“
Cole ist genauso planlos wie ich. Jackpot.
Ich atme tief durch, versuche, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Lage ist ziemlich beschissen. Mir ist klar, dass wir alles daransetzen müssen, dass sie nicht zum erstbesten Polizeirevier stürmt, um uns anzuschwärzen und sich in Gefahr zu bringen. Aber wie soll das gehen? Wie können wir das managen?
Selbst wenn sie uns schwört, es nicht zu tun, besteht dennoch ein Restrisiko.
Und ich hasse Risiken.
Wir kennen Brooklyn nicht, weshalb sie unberechenbar ist. Und unberechenbare Menschen sind gefährlich.
„Nichtsdestotrotz werden wir sie nicht gehen lassen“, sagt Cole bestimmt. „Ich bin der Präsident und habe eine Entscheidung getroffen. Zum Wohle des Clubs und zu ihrem eigenen Schutz.“
„Dass du den Club beschützen willst, verstehe ich. Aber wieso machst du solch einen Aufriss ihretwegen? Sie ist keine von uns, Cole“, erinnere ich ihn kleinlaut. „Unsere einzige Priorität sollte das Wohl des Clubs sein.“
Er mustert mich scharf. „Nein, sie ist keine von uns, aber Lucy ist so etwas wie eine Freundin. Eine Freundin, die viel durchmachen musste und die mir am Herzen liegt. Nenn mich meinetwegen eine Pussy, kein Problem. Ich stehe dazu, dass ich scheinbar doch so etwas wie ein Herz besitze.“
Ich schnaube leise.
Cole war einst härter, abgebrühter gewesen. Früher hätte er sich nicht eine Sekunde lang Gedanken um Brooklyns Schicksal gemacht. Aber seitdem Fallon in sein Leben getreten ist, hat er sich verändert. Er ist weicher und emotionaler geworden. Und noch weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist.
„Und wie stellst du dir das Ganze vor?“
„Du hast sie bei uns angeschleppt, also wirst du dich um sie kümmern“, sagt Cole grinsend. „Du trägst die Verantwortung für sie, bis die Situation unter Kontrolle ist.“
Ich starre ihn an. „Das ist nicht dein Ernst. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, oder?“
„Ganz und gar nicht.“
„Ich soll den Babysitter für eine Nonne spielen?“
„Korrekt.“
„Du weißt schon, dass das eine ganz beschissene Idee ist?“, frage ich.
„Ist es das?“ Lachend lehnt Cole sich in seinem Stuhl zurück. „Ach, Anson, ich dachte, du bist jeder Herausforderung gewachsen.“
Leise fluchend schüttle ich den Kopf.
Es will einfach nicht in meine Birne, wieso Cole wegen einer Nonne einen solchen Aufriss veranstaltet. Klar, er ist um die Sicherheit des Clubs besorgt, aber mir deshalb einen Klotz ans Bein binden? Ich habe keine Lust darauf, den Aufpasser zu spielen. Wenn ich nur daran denke, könnte ich kotzen.
„Ich liebe Herausforderungen“, teile ich ihm sarkastisch mit, denn egal, was ich sage, es wird nichts an seiner Entscheidung ändern. „Wäre das dann alles?“
„Noch nicht ganz“, entgegnet Cole ruhig. „Sieh diese Aufgabe nicht als Bestrafung an, Anson. Du wirst auf sie achtgeben und ihr Vertrauen gewinnen, weil du der richtige Mann für diesen Job bist. Ich weiß, dass dir das nicht schmeckt, genauso wie ich weiß, wie wichtig dir der Club ist. Und exakt aus diesem Grund vertraue ich dir ihr Leben an.“
Ich lasse seine Aussage unkommentiert stehen, nicke ihm zu, stehe auf und verlasse sein Büro. Angepisst kehre ich in die Bar zurück und geselle mich zu Matt und Landon.
„Wie wars bei Cole? Wie ich sehe, ist dein Kopf noch dran“, meint Landon lachend, der gerade dabei ist, mit einer Hand seine Dartpfeile aus dem Board zu ziehen.
„Er hat mir die Nonne aufs Auge gedrückt. Sie bleibt wohl vorerst hier.“
„Wieso?“, hakt Matt nach.
Ich nehme meine Kippenschachtel aus der Hosentasche, zünde mir eine Zigarette an und ziehe daran. Der Rauch kratzt angenehm in meiner Kehle, als ich ihn langsam wieder ausstoße.
„Weil Cole Schiss hat, dass sie zu den Bullen rennt und uns anschwärzt.“ Ich spucke den Satz aus, als würde er mir bitter auf der Zunge liegen. „Er will keinen Stress mit den Cops.“
Matt brummt zustimmend. „Verständlich. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie die Polizei es hinbekommen hat, aber nach dem Gemetzel in der Lagerhalle war kein Sterbenswörtchen davon in den Medien. Als hätte es die Reapers nie gegeben.“
Mein Bruder spielt auf den Abend an, an dem wir Charleen aus den Fängen der Reapers befreit und jeden einzelnen dieser Bastarde ausgelöscht haben. Ich sehe die Bilder noch vor mir – das Blut auf den Fußböden, die Schreie der Männer, bevor wir ihnen endgültig den Rest gegeben haben. Es war dreckig. Schnell. Gnadenlos. So, wie es sein musste.
Landon, der Diplomatischste von uns, der stets genauestens alle Für und Wider abwägt, mustert mich einen Moment lang. „Wir müssen die Füße stillhalten. Die Polizei hat es so aussehen lassen, als wäre ein Streit innerhalb der Reapers eskaliert. Und glaubt mir, das hat uns eine Menge Kohle gekostet.“ Sein Blick geht zu mir, dann zu Matt. „Außerdem liegt uns die Information vor, dass uns die DEA auf dem Kieker hat. Wir müssen eine Weile unter ihrem Radar fliegen und vorsichtig sein. In ein paar Monaten sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus.“
Ich presse meine Lippen zusammen, drücke meine Kippe im Aschenbecher aus und bestelle mir beim Barmann einen Drink.
Stillhalten.
Vorsichtig sein.
Unter dem Radar fliegen.
Das ist nicht gerade meine Stärke. Aber wenn Cole es so will, dann halte ich mich daran – zumindest fürs Erste.
Als der Barkeeper mir endlich meinen Whiskey rüberschiebt, leere ich das Glas in einem Zug. Der Alkohol brennt in meiner Kehle, und ich genieße das Gefühl.
„Soll ich Leah bitten, Klamotten für deinen Gast zu besorgen? Die Kleine kann wohl kaum in ihrem Nonnengewand durch den Club spazieren, oder?“, wechselt Landon das Thema.
Ich nicke.
Mein Bruder hat recht. Sie braucht normale Kleidung, um nicht aufzufallen. Hier im Club weht ein anderer Wind als im Kloster. Vermutlich wird es verdammt schwer für sie, sich bei uns einzuleben. Keiner der Jungs ist gläubig, genauso wenig wie ich. Ich glaube weder an Gott noch an die Jungfrau Maria oder an die Auferstehung Christi. Meine Religion ist der Club, die Sons of Devil.
Ich bestelle mir noch einen Whiskey, der prompt geliefert wird, und betrachte nachdenklich die bernsteinfarbene Flüssigkeit.
Manchmal frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn ich damals nicht auf Billy-Joe getroffen wäre. Wahrscheinlich wäre ich unter der Erde gelandet.
Bevor ich zu den Devils gekommen bin, war mein Leben ein einziger verdammter Scherbenhaufen. Ich hatte meinen Job als Automechaniker verloren – nicht weil ich schlecht darin war, sondern weil ich öfter bekifft als bei klarem Verstand war. Meine Freundin hat mich verlassen, weil sie genug von meinen Eskapaden hatte. Ich konnte es ihr nicht einmal verübeln. Ich habe mich ihr gegenüber wie ein Arsch aufgeführt, war ein hoffnungsloser Fall.
Das Gras wurde zu meinem besten Freund.
Irgendwann konnte ich die Miete für meine Bude nicht mehr aufbringen und landete auf der Straße. Ich schlief unter Brücken, in Hauseingängen, überall dort, wo es halbwegs trocken war. Ich schnorrte die Leute um Geld für Essen an, aber meistens gab ich die erbettelte Kohle für Gras aus.
Mein Leben war im Arsch.
Am Tiefpunkt meiner Existenz angekommen begegnete ich Billy-Joe. Ich hatte ihn um ein paar Dollar angeschnorrt, aber anstatt mir Geld in die Hand zu drücken, besorgte er mir ein Motelzimmer für die Nacht. Vermutlich, weil er wusste, dass ich mir von der Kohle Weed kaufen würde. Als ich ihn gefragt habe, wieso er mich in einem Motel einquartiert hat, meine er, dass ich ihn an seinen Bruder erinnern würde – einen Kerl, der nach seiner Zeit bei der Armee nie wieder richtig Fuß gefasst und sich letztlich sogar das Leben genommen hatte.
Billy-Joe nahm sich meiner an. Er half mir wieder auf die Beine. Wir trafen uns jeden Tag, sprachen miteinander und aßen zusammen. Er sah in mir nicht den Penner, der ich nun mal war, sondern sagte, dass ich bloß eine schwierige Phase durchmachen würde. Wieso er mir geholfen hat, habe ich bis heute nicht verstanden. Denn je mehr er mir von seinem Bruder erzählte, desto sicherer war ich mir, nichts mit ihm gemein zu haben.
Sein Bruder war ein Held, der unserem Land gedient hatte. Er war auf Einsätzen in Afghanistan und dem Irak, hat Männer und Frauen an der Front sterben sehen. Als er bei seinem letzten Einsatz durch eine Bombe ein Bein verloren hatte, wurde er aus dem Dienst entlassen, womit er nicht zurechtkam.
Ich habe nichts Großes geleistet, außer mein Leben vor die Wand zu fahren.
Und trotzdem kümmerte sich Billy-Joe um mich. Er erzählte mir immer wieder Geschichten über Zusammenhalt, Loyalität und eine Familie, die sich nicht durch Blut, sondern durch Vertrauen definiert. Und während ich ihm ins Gesicht blickte, erkannte ich in seinen Augen etwas, das mir fremd und doch so vertraut war.
Verlorenheit.
Billy-Joe gab mir eine Perspektive. Und diese Perspektive waren die Sons of Devil.
Es dauerte eine Weile, bis ich wieder in der Spur und vor allem weg vom Gras war. Als ich mich halbwegs wieder wie ein Mensch fühlte, wurde ich Prospect bei den Devils, nachdem Billy-Joe mir einen Einblick in das Clubleben gegeben hatte. Meine Anwärterzeit war hart, vielleicht härter als alles andere zuvor. Schließlich musste ich mich beweisen. Aber es hat sich gelohnt, denn der Club gab mir einen neuen Lebensinhalt, eine zweite Chance.
Billy-Joe und die Devils haben mich gerettet, und dafür schulde ich ihnen mein Leben.
Ohne sie würde es mich wahrscheinlich nicht mehr geben. Deshalb ist der Club meine Religion.
„Was hast du denn nun mit der Kleinen vor?“, fragt Matt und reißt mich damit aus den Gedanken.
„Was wohl? Sie mit zu mir nach Hause nehmen und das tun, was Cole von mir verlangt: ihren Babysitter spielen und ihr Vertrauen gewinnen.“
„Vielleicht können dich die Frauen, Charleen, Fallon und Leah, dabei unterstützten“, schlägt Landon vor. „Brooklyn wird sich mit ihnen sicherlich wohler fühlen als mit uns.“
„Jepp, sehe ich auch so“, stimmt Matt ihm zu. „Sie ist eine Nonne, Mann. Mit Schwänzen kennt sie sich nicht aus.“
Ich lache. „Halt die Fresse, Matt.“
Grinsend hebt er die Hände. „Ich sags ja nur. Denk mal drüber nach.“
Ich stelle mein mittlerweile leeres Glas auf der Theke ab. „Ich bring sie erst mal zu mir, dann sehe ich weiter.“
„Vorausgesetzt, dass sie überhaupt mit dir geht“, gibt Landon zu bedenken.
„Hat sie denn eine Wahl?“
„Nein, die hat sie nicht, aber es wäre für alle Beteiligten das Beste, wenn sie aus freien Stücken mit dir mitkommt“, entgegnet Landon.
„Dem kann ich nur zustimmen“, pflichtet Matt ihm bei. „Erinnert ihr euch noch an die ersten Tage mit Fallon? Mein Mädchen hat mir das Leben verdammt schwer gemacht.“
„Du vergleichst hier gerade Äpfel mit Birnen, Alter. Du hast Fallon gefoltert und sie anschließend bei dir zu Hause eingesperrt. Du solltest dankbar sein, dass du noch beide Eier hast“, spotte ich.
Fallons und Matts Vorgeschichte ist nicht mit dieser Situation zu vergleichen, weshalb ich in dieser Sache einen Scheiß auf seine Meinung gebe.
Obwohl Matt Gefühle für Fallon hatte, hat ihn das damals nicht davon abgehalten, sie auf Befehl des Clubs in unseren Folterkeller zu schleifen. Und warum? Weil wir geglaubt hatten, dass sie etwas mit Charleens Verschwinden zu tun haben könnte. Damals wussten wir noch nicht, dass die Reapers sie hatten. Fallon war die Einzige mit einem möglichen Motiv, also haben wir uns auf sie gestürzt.
Charleen und sie hatten zusammen einen Schönheitssalon eröffnet. Dann hatte Charleen angedeutet, dass sie nach ihrer Hochzeit aussteigen würde. Fallon hätte also Angst haben können, ihre Existenz zu verlieren. Damals klang diese Erklärung für uns plausibel, aber heute?
Heute kenne ich Fallon. Sie ist nicht der Typ, der jemanden verschwinden lässt. Sie ist harmloser als eine verdammte Fliege. Aber Logik und Gefühle haben in unserer Welt keinen Platz. Wenn ein Befehl kommt, wird dieser befolgt – egal, was man denkt, egal, was man fühlt.
„Nicht, dass dir das Gleiche wie Matt passiert. Nicht, dass du dich Hals über Kopf in das fromme Lämmchen verliebst“, zieht Landon mich grinsend auf.
Ich schnaube verächtlich. „Scheiße, nein. Ich werde mich ganz bestimmt nicht in einen prüden, gottesfürchtigen Pinguin vergucken. Eher friert die verdammte Hölle zu.“
Was für eine absurde Vorstellung – ich und eine Nonne?
Ich stehe auf Frauen, die wissen, was sie wollen – besonders im Bett. Ich mag es, wenn meine Sexpartnerinnen keinerlei Hemmungen haben, wenn sie wissen, wie man einen Schwanz bläst und einen Mann verführt. Besonders geil finde ich Dirty Talk und wenn es rauer zur Sache geht.
Zugegeben, ohne ihre komische Nonnenhaube und mit den richtigen Klamotten könnte Brooklyn durchaus heiß sein. Sie hat ein hübsches Gesicht, tolle Augen und durchaus küssbare, volle Lippen. Nichtsdestotrotz stehe ich nicht auf verklemmte Weiber. Wahrscheinlich würde Brooklyn einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie einen Schwanz aus nächster Nähe sieht.
„Amen. Dein Wort in Gottes Ohr, Bruder“, witzelt Landon und wirft anschließend seine Pfeile auf die Scheibe.
Na toll, das kann ja heiter werden, wenn ich mir von jetzt an ständig solche Kommentare reinziehen darf.
Halleluja!
Brooklyn
Langsam öffne ich die Augen und blinzle gegen das Licht an, das durch die Vorhänge ins Schlafzimmer dringt. Mein Körper fühlt sich an, als hätte ich die Nacht im Beichtstuhl verbracht – steif, schmerzend und kraftlos. Jede Bewegung schickt eine Welle des Schmerzes durch meine Rippen, und mein Kopf pocht dumpf im Takt meines Herzschlags. Und trotzdem fühle ich mich schon deutlich besser als noch vor ein paar Stunden.
Ich lebe. Ich wurde nicht vergewaltigt. Ich befinde mich nicht in der dunklen Unterführung des Parks, in den Fängen dieser Männer.
Ich lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. Es ist ein schlicht eingerichtetes Zimmer mit massiven Holzmöbeln, in dem es nach kaltem Zigarettenrauch und nach Leder riecht. Außerdem liegt der Geruch von Motoröl in der Luft.
Nachdem ich nach dem Übergriff wieder bei Bewusstsein gewesen war, hat sich eine junge Frau, die sich mir als Leah vorgestellt hat, um mich gekümmert. Ihre sanften Berührungen waren ein starker Kontrast zu den brutalen Händen der Kerle, die mich festgehalten und geschlagen hatten. Ich schaudere, als die Erinnerung wieder hochkommt – die Angst, die Hilflosigkeit. Prompt zieht sich mein Magen zusammen, und meine Hände werden feucht.
Plötzlich sehe ich ihn vor mir: den Mann, der mich gerettet hat. Zunächst war sein Gesicht in Schatten gehüllt gewesen, aber die Entschlossenheit in seinen Augen war unübersehbar.
Er ist ein Riese – mit breiten Schultern, strammen Oberarmen und kräftigen Beinen. Alles an ihm wirkt massiv, fast bedrohlich, und doch bewegt er sich mit der Geschmeidigkeit einer Raubkatze, was fasziniert. Sein nussbraunes kurzes Haar sieht aus, als würde er morgens nur einmal durchwuscheln, und sein Dreitagebart verleiht ihm einen rauen, ungezähmten Look.
Und dann wären da noch seine Augen. Ich kann nicht einmal genau sagen, welche Farbe sie haben – mal scheinen sie dunkler, mal heller.
Ich schätze ihn auf Ende zwanzig, Anfang dreißig, da er bereits erste kleine Fältchen um die Augen und auf der Stirn hat. Er ist tätowiert – die Arme von Tinte bedeckt, ebenso sein Hals. Als er vorhin das Zimmer verlassen hat, meine ich, ebenfalls schwarze Linien in seinem Nacken erkannt zu haben. Vermutlich hat er auch auf seinem Rücken Tattoos.
Wäre ich ihm irgendwo auf der Straße begegnet, hätte ich mit Sicherheit einen großen Bogen um ihn gemacht. Er wirkt einschüchternd, angsteinflößend, wie jemand, mit dem man sich besser nicht anlegt. Ich hätte ihn als Bad Boy abgestempelt. Aber da sieht man mal wieder, dass die Optik täuschen kann. Er hat Zivilcourage bewiesen, und ohne ihn wäre ich jetzt vielleicht nicht in Sicherheit.
Ich atme tief durch, ignoriere den Schmerz an meiner Seite und setze mich vorsichtig auf. Mein Blick fällt auf eine Wasserflasche, die auf dem Nachttisch steht. Als ich mit zittrigen Fingern nach ihr greifen möchte, vernehme ich ein leichtes Klopfen an der Tür und zucke zusammen. Kurz darauf wird sie geöffnet.
„Alles in Ordnung bei dir, Liebes? Wie fühlst du dich?“ Leahs sanfte Stimme weht durch den Raum.
„Alles gut, danke.“
Sie betritt das Zimmer. Ihre blonden Haare sind zu einem unordentlichen Dutt zusammengebunden. Leah trägt ein Jeanskleid, das sehr teuer und hochwertig verarbeitet aussieht. In ihren Händen hält sie eine Schale mit dampfender Suppe und sie lächelt mir zu.
„Ich habe für dich gekocht, weil ich dachte, dass du bestimmt etwas Warmes im Magen gut vertragen kannst“, sagt sie.
Wie aufs Stichwort knurrt mein Magen verräterisch. „Danke schön“, entgegne ich und nehme die Schüssel entgegen.
Ich probiere einen Löffel. Die warme Hühnerbrühe rinnt mir die Kehle hinab, wärmt mich von innen heraus und vertreibt einen Teil meiner inneren Kälte.
Leah lässt sich auf dem Rand des Bettes nieder und mustert mich aufmerksam. „Du siehst deutlich besser aus als vorhin. Aber du hast immer noch diesen Blick.“
„Welchen Blick?“
„Den, den Frauen haben, wenn sie sich wieder sicher fühlen wollen, es aber nicht können.“ Sie verschränkt die Arme vor der Brust. „Ich habe ihn schon oft gesehen. In diesem Club leben viele Menschen mit Narben – innerlichen sowie äußerlichen.“
Ich sehe sie schweigend an, denn ihre Worte setzen mir zu.
„Willst du darüber sprechen, was dir im Park widerfahren ist? Ich bin eine gute Zuhörerin.“
Ich schüttle den Kopf. „Nein.“
Leah nickt, als hätte sie genau mit dieser Antwort gerechnet. „Das verstehe ich, Liebes. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und wenn du irgendwann so weit bist, kannst du dir sicher sein, dass ich hier bin.“
Es entsteht ein Moment der Stille zwischen uns. Nur das leise Klappern meines Löffels gegen den Schalenrand durchbricht sie.
Leah lehnt sich grinsend zu mir vor. „Übrigens, Anson steht vor der Tür und wartet.“
„Anson?“
Leah lacht. „Der Mann, der dir zu Hilfe gekommen ist.“
Ja, ich weiß, wer Anson ist. Aber wieso ist er hier?
Mein Herz setzt einen Schlag aus und mein Brustkorb wird um einiges enger. Ich weiß nicht, wieso der Gedanke an ihn diese körperliche Reaktion auslöst. Vielleicht, weil er der Grund ist, wieso ich nicht vergewaltigt wurde?
Leah steht auf. „Ich schick ihn zu dir rein, ja?“
Ich öffne den Mund, um ihr zu antworten, aber da ist sie auch schon aufgesprungen und zur Tür hinausgeeilt.
Mein Herz klopft immer schneller und schneller. Ich gebe mir Mühe, meine plötzliche Nervosität mit tiefen Atemzügen unter Kontrolle zu bringen, aber es klappt nicht.
Dann geht die Tür wieder auf.
Und er steht da.
Mit seiner breiten Statur füllt er den Türrahmen fast gänzlich aus und mustert mich mit seinen dunklen Augen. Die Lederweste, die er trägt, sieht abgetragen aus, als hätte sie schon einiges mitgemacht. Seine Beine sind von einer Jeans umhüllt, und seine Füße stecken in groben Boots. Er wirkt auf mich wie jemand, der harte Zeiten gewohnt ist.
„Hey“, begrüßt er mich mit seiner tiefen Stimme. „Wie geht es dir?“
Er begibt sich in den Raum, bleibt dann jedoch stehen, als wolle er mir nicht zu nahe kommen.
Ich zucke leicht mit den Schultern, verspüre allerdings sofort einen Schmerz und verziehe das Gesicht. „Besser.“
Er nickt, und einen Augenblick lang herrscht Stille.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vermutlich sollte ich mich bei ihm bedanken. Ihm dafür danken, dass er mich gerettet hat, aber mir bleiben die Worte im Halse stecken.
Stattdessen blicke ich ihm in die Augen. Da ist nichts Aufdringliches in seinem Blick. Keine Erwartungen. Nur … Sorge?
„Wieso hast du mir geholfen?“ Die Frage ist mir, warum auch immer, schneller über die Lippen gekommen, als ich denken konnte.
„Weil du Hilfe gebraucht hast.“
Seine Antwort ist so simpel, so selbstverständlich, dass sie mich für einen Moment sprachlos macht.
Ich schenke ihm ein zaghaftes Lächeln, das er erwidert. Mein Herz macht einen Sprung.
Wieso er eine solche Wirkung auf mich hat, ist mir ein Rätsel. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären.
Nur weil ich eine Novizin bin, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass ich blind bin. Es gibt durchaus Männer, die ich attraktiv finde. Ian Somerhalder, Pann Badgley oder Cole Sprouse zum Beispiel, die ich in Serien gesehen habe. Und ich gebe auch zu, dass der Gedanke an Sex hin und wieder sehr verlockend ist. So reizvoll, dass ich mich das ein oder andere Mal selbst berührt habe, aber einen Höhepunkt habe ich dabei nie erlebt. Keine Ahnung, ob ich etwas falsch gemacht habe.
Wie dem auch sei, Anson löst etwas in mir aus. Genauer definieren kann ich es nicht. Ich weiß bloß, dass mir diese Empfindungen völlig fremd und überaus verwirrend sind.
Ist es Dankbarkeit, weil er mir zu Hilfe gekommen ist?
Regt sich etwas in mir, wie ein warmes Gefühl, weil er sich sorgt?
Ich weiß es nicht.
Allerdings scheint er zu merken, dass er mich aus dem Konzept bringt, denn er grinst mich wissend an. „Du siehst aus, als würdest du jeden Moment aus dem Bett springen und davonlaufen, Brooklyn.“ Seine tiefe, maskuline Stimme schwingt zwischen Spott und etwas anderem, das ich nicht ganz greifen kann.
Ich schlucke hart. „Nein, ich laufe nicht weg.“
„Gut.“ Er hebt eine Augenbraue und mustert mich mit unverhohlener Neugier.
„Ich … ähm … wollte mich noch bei dir dafür bedanken, dass du mir zu Hilfe gekommen bist“, sage ich, als mir seine Blicke zu intensiv werden. „Wärst du nicht gewesen …“
Er zuckt mit den Schultern. „Schon gut, das war keine große Sache.“
Keine große Sache? Das sehe ich vollkommen anders.
„Doch, das war es. Es gibt heutzutage nicht mehr viele Menschen, die Zivilcourage beweisen. Entweder schauen die Leute weg oder zücken ihr Handy, um ein gutes Video für Instagram zu bekommen. Selten mischt sich jemand ein.“
Er hebt eine Augenbraue. „Du kennst Insta?“
„Ich lebe nicht auf dem Mond. Zwar habe ich keinen Account, weil ich kein eigenes Handy oder einen Laptop besitze, aber manchmal, wenn ich Texte für einen Gottesdienst vorbereiten muss und Zugang zu einem PC habe, schaue ich mich heimlich in den sozialen Netzwerken um.“
Er lacht auf und entblößt dabei seine Zähne – schön, gerade, strahlend weiß. „Ui, wie gefährlich. Du scheinst ja ein ganz böses Mädchen zu sein.“
„Im Kloster sind solche Webseiten verboten. Ich würde nicht behaupten, dass ich böse bin, sondern einfach nur neugierig.“
„Wie alt bist du eigentlich?“, möchte er wissen.
„Einundzwanzig, und du?“
Ein Grinsen huscht über sein Gesicht. „Also noch ein Küken. Ich bin vor zwei Wochen dreißig geworden.“
„Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Anson.“
„Danke.“
Für einen Moment schweigen wir, und in dieser Stille liegt etwas, das ich nicht benennen kann. Ich weiß nur, dass die Ruhe unangenehm ist, weshalb ich das Wort ergreife.
„Wann … ähm … wäre es vielleicht möglich … Ich würde gern nach Hause gehen“, stammle ich. „Mir geht es schon viel besser, und meine Schwestern machen sich bestimmt große Sorgen um mich.“
Anson verschränkt die Arme vor seiner breiten Brust und bedenkt mich mit einem unergründlichen Blick, der mich einerseits fasziniert und andererseits völlig verunsichert. „Du wirst wohl noch eine Weile bei uns bleiben müssen.“
„Was heißt eine Weile? Ein paar Stunden?“
Er zuckt mit den Schultern. „Wohl eher Wochen, vielleicht ein paar Monate. Keine Ahnung.“
Geschockt klappt mir die Kinnlade hinunter. „Wieso?“
„Weil du Jay, deinen Angreifer, beschreiben kannst, der einer unserer Dealer ist, und wir keinen Ärger mit den Cops gebrauchen können.“
„Ich habe nicht vor, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten.“
Er lacht trocken auf. „Und das soll ich dir einfach so glauben?“
„Ich bin Novizin, Anson. Wir halten immer Wort. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, so lautet das neunte Gebot. Ich lebe die zehn Gebote, also lüge ich nicht“, versichere ich ihm. „Ich möchte nur zurück zu meinen Schwestern, das ist alles.“
„Vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht. Wir kennen dich nicht, Brooklyn, und können es uns nicht leisten, ein Risiko einzugehen.“
Ich schüttle den Kopf. „Ich bin kein Risiko. Ihr seid ganz schön paranoid.“
„Nein, das nennt sich die harte Schule des Lebens, Schätzchen“, sagt er. „Würden wir uns immer auf das Wort unseres Gegenübers verlassen, wären wir heute nicht dort, wo wir sind. Wir wären verraten und verkauft. Lass mich dir einen Rat geben: Die Menschen erzählen einem immer das, was man hören will, wenn man sie in die Ecke drängt. Und passt man einen Moment nicht auf, rammen sie dir von hinten brutal ein Messer in den Rücken.“
„Es tut mir sehr leid, dass du, dass ihr, diese Erfahrungen machen musstest, aber so bin ich nicht.“ Meine Stimme ist fest, aber ruhig. Ich muss ihn überzeugen, mich gehen zu lassen, auch wenn ich nicht weiß, wie. „Ja, du kennst mich nicht, aber du kannst mir vertrauen. Ich halte immer Wort und werde dich nicht hintergehen. Was kann ich tun, damit du mir glaubst? Es schriftlich machen? Eine Erklärung unterzeichnen? Bitte, Anson. Meine … meine Schwestern …“ Ich klammere mich an den letzten Strohhalm. „Sie wissen nicht, wo ich bin und was passiert ist. Wenn ich dem Kloster noch länger fernbleibe, werden sie die Polizei verständigen.“
„Deine Schwestern wissen Bescheid“, teilt Anson mir mit.
Ich blinzle verwirrt. „Sie wissen Bescheid?“ Mein Herz setzt für einen Moment aus, und ich starre ihn fassungslos an. „Das soll wohl ein Scherz sein, oder? Du willst mich auf den Arm nehmen? Wo ist die versteckte Kamera?“
„Sehe ich aus, als wäre ich ein Komiker?“
Nein, das tut er nicht.
Nicht mit diesen nunmehr harten Gesichtszügen und den dunklen Augen, die mich abwartend mustern.
„Cole hat mit Schwester Lucy gesprochen und ihr erzählt, was passiert ist. Die zwei sind übereingekommen, dass du momentan bei uns am besten aufgehoben bist.“
Lucy.
Die Ordensälteste.
„Am besten aufgehoben?“ Ich komme mir wie ein Papagei vor, der alles nachplappert.
Anson nickt.
„Wieso? Wegen der Jungs im Park? Diese Vorsichtsmaßnahme scheint mir ein wenig übertrieben. Sie werden schon nicht ins Kloster eindringen, um ihre begonnene Tat zu vollenden.“
„Das vielleicht nicht, aber wir haben unsere Gründe.“
„Gründe? Was für Gründe?“
Er rauft sich die Haare, was ich als ein Zeichen wachsender Ungeduld werte. „Ich führe nur die Befehle vom Prez aus. Und seine Anweisung lautet, dass du eine Weile bei mir bleiben wirst.“
Mein Magen zieht sich zusammen. „Ich möchte mit Cole sprechen. Ich werde ihm versichern, dass ich keine Anzeige erstatten werde.“ Meine Stimme bebt. Ich bin den Tränen nah, weigere mich aber, hier und jetzt die Kontrolle zu verlieren.
Anson hebt eine Augenbraue. „Wenn es etwas zu besprechen gibt, wird Cole das Gespräch mit dir suchen. So lange wirst du dich wohl oder übel in Geduld üben und mit mir vorlieb nehmen müssen.“
Ich presse meine Lippen zusammen und starre ihn an.
Seine verrückten Worte hallen in meinem Kopf wider.
Weil du Jay, deinen Angreifer, beschreiben kannst, der einer unserer Dealer ist, und wir keinen Ärger mit den Cops gebrauchen können.
Meine Schwestern wissen Bescheid.
Sie haben zugestimmt, dass ich hierbleibe.
Aber wieso?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lucy oder die Äbtissin es gutheißen, dass ich mich in einem Clubhaus voller Biker aufhalte. Die zwei sind seit Jahren Dienerinnen Gottes, sie leben die Regeln wie keine anderen.
Das ergibt keinen Sinn.
Es sei denn …
Abermals zieht sich mein Magen zusammen.
Es sei denn, es steckt noch mehr dahinter.
Bloß, was?
Ist das hier meine Strafe, weil ich Nachforschungen im Archiv angestellt habe? Hat diese ganze Sache etwas mit meiner Herkunft zu tun?
Es kann nicht allein um die Angst dieser Leute gehen, dass ich mich möglicherweise an die Polizei wenden könnte.
Panik macht sich in mir breit, sodass ich trotz meiner Verletzungen und Schmerzen aus dem Bett springe und losmarschiere, ohne zu wissen, wohin. Hauptsache weg von Anson und raus aus diesem Club. Doch ehe ich die Schlafzimmertür erreiche, legt Anson eine Hand um mein Handgelenk und hält mich zurück.
„Brooklyn.“ Sein Tonfall ist nun deutlich schärfer als zuvor. „Wo willst du hin?“
Ich reiße mich von ihm los. „Weg von hier.“
„Daraus wird leider nichts.“ Sein Blick ist eindringlich, und ich spüre deutlich die unterschwellige Warnung darin.
Ich balle meine Hände zu Fäusten. „Du kannst mich nicht gegen meinen Willen hier einsperren.“
Er seufzt auf. „Ich sperre dich nicht ein, wenn du dich fügst. Kapier es endlich: Du kannst nicht gehen. Nicht, solange ich für dich verantwortlich bin.“
„Für mich verantwortlich?“ Ich lache bitter auf. „Wieso sollte ich dir vertrauen? Ich kenne dich überhaupt nicht. Genauso wenig wie ich verstehe, was diese Aktion soll.“
„Und doch wurdest du nicht vergewaltigt, oder?“
Ich blinzle.
„Wenn ich dir im Park nicht zu Hilfe gekommen wäre, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht so putzmunter vor mir stehen.“
Ein Schauer läuft mir über den Rücken.
In dieser Sache hat er recht.
Punkt für ihn.
Aber das macht es nicht einfacher, verständlicher für mich, zu akzeptieren, dass ich zeitweise in einer Welt leben soll, die mir gänzlich fremd ist.
Ich will es verstehen. Wirklich. Aber es ergibt keinen Sinn.
Meine Schwestern haben mich gegen meinen Willen diesen Menschen überlassen, und ich habe keinerlei Einfluss darauf. Ich hätte es vielleicht verstanden, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht hätte, aber ich war doch bloß zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Außerdem habe ich Anson versichert, dass die Polizei kein Thema ist.
Also, wieso?
„Ich verstehe, dass du Antworten willst“, sagt Anson nun deutlich versöhnlicher.
Ich hebe den Kopf und nicke.
„Dann warte, bis Cole sie dir gibt.“
Seine Entschlossenheit ist nahezu greifbar. Ich könnte diskutieren, schreien, toben, weinen – es wird rein gar nichts ändern.
Ich soll mich in Geduld üben?
Mal wieder.
Das bekomme ich täglich zu hören, seit Jahren.
Ich soll darauf warten, dass ein Mann, den ich nicht kenne, entscheidet, wann ich wieder nach Hause darf?
Ich habe mein Leben lang Regeln befolgt, mich vertrösten lassen und mich in Geduld geübt.
Irgendwann ist Schluss damit.
„Du kannst nicht über mich bestimmen“, fauche ich.
Er grinst.
Es ist dieses gefährliche, herausfordernde Lächeln, das mich gleichermaßen in den Wahnsinn treibt und mir den Atem stocken lässt.
„O doch, das kann und das werde ich. Du stehst ab sofort unter meinem Schutz, Brooklyn Heart.“
Ich presse die Lippen aufeinander.
Zwar bin daran gewöhnt, dass man mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, wann es angebracht ist, zu beten, zu schweigen, zu arbeiten oder zu essen, aber ich habe es mir so ausgesucht. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich das Kloster jederzeit verlassen können.
Jetzt fühlt es sich so an, als hätte ich keinerlei Kontrolle.
Und ich hasse dieses Gefühl.
„Das ist so absurd. Ich bin doch keine Gefangene“, murmle ich.
„Nein, aber momentan steht es dir nicht frei, zu gehen.“ Seine Stimme ist leise, fast sanft. „Nicht, bis wir geregelt haben, was es zu regeln gibt.“
Was gibt es denn zu regeln?
Er hat mein Wort, dass ich nicht zur Polizei gehen werde. Wollen sie mir das Gehirn waschen und die Erinnerungen an das Passierte auslöschen?
Ich verstehe nur noch Bahnhof.
Wochen.
Monate.
So lange soll ich hierbleiben?
Inmitten einer fremden, wahrscheinlich sehr gefährlichen Welt?
Meine Kehle wird immer enger. „Ich kann nicht.“
„Doch, du kannst.“
Ich schließe meine Augen.
Es gibt scheinbar kein Entkommen.
Und was mir am meisten Angst macht, ist nicht die Tatsache, dass ich bleiben muss. Sondern, dass ein Teil von mir das vielleicht gar nicht so schlimm findet.
Nachdem Anson mich wieder ins Bett verfrachtet hat, ist er gegangen. Er hat gemeint, er würde später noch einmal nach mir sehen, und ich bräuchte gar nicht erst versuchen zu fliehen. Vor meiner Tür würden zwei Prospects Wache schieben. Keine Ahnung, was Prospects sind, aber ich habe keinerlei Interesse daran, es herauszufinden.
In meinem Kopf geht es drunter und drüber.
Ich kann nicht aufhören, über unser Gespräch und das Kloster nachzudenken. Wieso hat die Äbtissin diesem Irrsinn zugestimmt? Warum hat sie entschieden, dass ich bei diesen Fremden besser aufgehoben bin als zu Hause?
Etwas stimmt nicht.
Etwas fühlt sich grundlegend falsch an.
In mir wächst das nagende Gefühl, dass die ganze Sache etwas mit meiner Herkunft zu tun hat.
Bloß, was?
Ich muss mit Cole sprechen. Vielleicht hat er die Lösung zu diesem Rätsel.
Aber wie komme ich an ihn heran?
Meine Gedanken kommen zum Erliegen, als es an meiner Zimmertür klopft. Bevor ich antworten kann, wird die Tür geöffnet, und Leah betritt den Raum – mit zwei weiteren Frauen im Schlepptau.
„Hi, Liebes, wie geht es dir?“, erkundigt sie sich.
Ich schnaube. „Wie soll es mir schon gehen? Man hält mich hier gefangen. Dabei möchte ich nur nach Hause.“
Leah tritt zu mir ans Bett. „Ich möchte dir meine besten Freundinnen vorstellen. Das sind Fallon und Charleen.“
„Hey“, erwidere ich der Höflichkeit halber und probiere, den Frauen ein Lächeln zu schenken.
„Charleen ist Coles Old Lady, und Fallon ist mit Matt zusammen“, erklärt sie mir. „Mein Partner heißt Landon.“
Ich blinzle. „Old Lady?“ Auf mich wirkt diese Charleen alles andere als alt.
Charleen lacht leise. „Eine Old Lady ist die Ehefrau eines Bikers. Nicht nur vor dem Gesetz, sondern weit darüber hinaus.“
Ich runzle die Stirn. „Also vor Gott?“
Fallon grinst. „Mit Gott hat das nichts zu tun. Der Titel sagt aus, dass die Frau für andere Männer im Club tabu ist. Unantastbar. Eine Old Lady zu sein bedeutet in unseren Kreisen, die höchstmögliche Stellung innezuhaben.“
Ich nicke. „Oh, okay.“
Ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was sie mir zu erklären versucht, belasse es aber dabei.
Charleen setzt sich zu mir auf die Bettkante und mustert mich mit einer Mischung aus Neugier und Verständnis. „Du hast sicherlich eine Menge Fragen, oder?“
Ich verschränke die Arme vor der Brust. „In der Tat, denn ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten. Ohne Antworten zu bekommen.“
Fallon seufzt. „Ja, das klingt ganz nach den Jungs.“
Leah nimmt am Fußende des Bettes Platz. „Wir wissen, dass das alles furchtbar verwirrend für dich sein muss, aber bei uns bist du sicher.“
„Schwebe ich denn in Gefahr? Warum lässt man mich nicht gehen?“
Die drei Frauen tauschen Blicke aus.
Schließlich ergreift Charleen das Wort. „Cole wird es dir erklären, Liebes. Gib ihm nur ein bisschen Zeit dafür.“
Zeit?
Ich presse die Lippen aufeinander.
Ich möchte Antworten, und zwar sofort.
„Wie viel Zeit?“
Charleen legt mir eine Hand aufs Knie. „Ich kann nachvollziehen, wie verwirrend und unbefriedigend all das für dich ist, aber Cole wird das Gespräch mit dir suchen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“
„Warum nicht jetzt?“
„Weil das nun mal in unserer Welt so abläuft.“ Charleen zuckt mit den Schultern.
„Man weiß nie, wem man trauen kann“, fügt Fallon hinzu.
„Das ist doch nicht normal“, wispere ich.
„Das liegt im Auge der Betrachterin, aber für uns ist das nun mal Realität“, meint Leah.
Ich ziehe die Decke enger um meinen Körper. „Ihr wisst, was los ist, oder? Ihr wisst, wieso ich nicht gehen darf.“
Leah atmet tief durch. „Es tut mir leid, aber wir können dir leider nicht weiterhelfen.“
Ich spüre, wie sich Wut in mir aufbaut. „Das ist schlimmer als ein Albtraum. Ihr tut so, als wäre es normal, eine Frau festzuhalten, die nichts Verbotenes getan hat. Es ist falsch. Ich bin nicht aus freien Stücken hier, was man in meiner Welt Freiheitsberaubung nennt.“
„Wir können deine Angst, dein Unverständnis sowie deine Unsicherheit nachvollziehen, Brooklyn“, meint Fallon ruhig.
„Nein, das könnt ihr nicht.“ Ich funkle sie an. „Ihr gehört hierher. Ihr seid Teil dieser Welt. Für euch scheint es nichts Besonderes zu sein, eine Frau gefangen zu nehmen.“
„Liebes, du bist weder unsere Gefangene, noch ist es für uns normal, Menschen zu kidnappen. Wir beschützen lediglich unsere Familie.“
Ich lache trocken. „Vor mir? Vor einer angehenden Nonne? Entschuldigt bitte, aber ihr merkt schon, wie lächerlich das klingt? Ich bin eine Dienerin Gottes, eine fromme Frau, die einfach nur in ihr Kloster zurückkehren möchte, um in Frieden zu leben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe es auch schon Anson versichert, eurer Familie wird nichts geschehen. Ich werde nicht zur Polizei gehen.“
Fallon und Leah tauschen einen kurzen Blick aus. Ich bin mir nicht sicher, was er bedeutet, aber mir gefällt das nicht.
„Wie wäre es, wenn du uns die Chance gibst, dir dabei zu helfen, unsere Welt zu verstehen. Vielleicht siehst du dann, dass wir nicht die Bösen sind und wieso Cole dich vorerst nicht gehen lassen kann.“
„Ich möchte eure Welt nicht verstehen“, entgegne ich kühl. „Ich will einfach nur nach Hause.“
„Weißt du, wir kennen deine Welt nicht, wissen nicht, wie das Leben im Kloster ist“, sagt Charleen, ohne auf meine Worte einzugehen. „Aber ich habe eine grobe Vorstellung davon. Unsere Welten sind gänzlich verschieden.“
Das ist die Untertreibung schlechthin. Ich bin mir sicher, dass ihre Realität meilenweit von meiner entfernt ist.
Aber vielleicht muss ich das Spiel einfach mitspielen? Vielleicht ist es das Klügste, wenn ich ihr Vertrauen gewinne. Wenn mir das gelingt, kann ich sie eventuell davon überzeugen, mich nach Hause zu bringen. Keine Ahnung, ob der Plan aufgeht, es käme auf einen Versuch an. Und schließlich ist es nicht so, als hätte ich massenweise Alternativen.
„Wir glauben nicht an Gott, halten uns an keine religiösen Gebote, beten nicht und überlassen nichts dem Schicksal“, erklärt Leah. „Unsere Welt ist grausam, brutal und unberechenbar. Du wirst sicherlich Dinge zu sehen bekommen, die dich schockieren, deine heile Weltanschauung auf den Kopf stellen werden, aber wir sind für dich da.“
Ich atme tief durch. „Versteht mich bitte nicht falsch, denn ich weiß euer Engagement sehr zu schätzen, aber ich würde wirklich gern zurück ins Kloster. Ich möchte im Garten arbeiten, an Gottesdiensten teilnehmen, beichten und beten. Ich möchte frei von Sünde bleiben, nicht in Versuchung geführt und eines Tages von dem Bösen erlöst werden.“
Und Antworten auf die Fragen erhalten, wer ich bin und wo ich herkomme, aber das behalte ich besser für mich.
„Anson hat uns erzählt, dass du dein ganzes Leben im Kloster verbracht hast. Hat es dich nie interessiert, wie das wahre Leben so ist? Wie es wäre, feiern zu gehen, Spaß zu haben, mit Freundinnen abzuhängen, über die Stränge zu schlagen, Jungs zu treffen oder in den Urlaub zu fahren?“, will Fallon wissen.
Die drei machen das wirklich geschickt, indem sie über all meine Einwände und Fragen hinweggehen, als wären sie nie ausgesprochen worden. Vermutlich verfolgen sie die gleiche Strategie wie ich: Vertrauen schaffen. Nun gut, ich mache mit, zumindest vorerst.
Ich lehne mich gegen das Kopfteil, verschränke die Arme vor der Brust und höre ihnen zu.
„Du bist so jung, Brooklyn“, fährt Fallon fort. „Dir steht die ganze Welt offen. Sieh deinen Aufenthalt bei uns doch einfach als eine Art Prüfung an. Eine Prüfung, ob du wirklich den richtigen Weg gewählt hast.“
Natürlich habe ich mich im Stillen schon gefragt, wie es wäre, ein gänzlich anderes Leben zu führen. Freunde zu treffen. Auf Partys zu gehen. Mich sexy zu kleiden. Mich zu schminken. Zu flirten. Vielleicht sogar einen Jungen zu küssen. Alles andere wäre gelogen. Aber Gott hat meinen Weg für mich vorherbestimmt.
Oder etwa nicht?
„Ich habe meine Wahl getroffen“, sage ich leise. „Gott wollte, dass ich seine Jüngerin werde.“
„Wollte er das?“, hakt Charleen ruhig nach.
„Natürlich.“
„Oder war es bloß der Weg, den man dir von klein auf gezeigt hat?“, will sie wissen.
Ich öffne den Mund, um ihr zu antworten, aber ich bekomme keinen Ton heraus. Tief in mir nagt nämlich Unsicherheit. War es wirklich meine Entscheidung, Nonne zu werden? Oder nur die einzige Möglichkeit, die ich zu haben glaubte?
„Es ist okay, seinen Werdegang infrage zu stellen. Es bedeutet nicht, dass du deinen Glauben verrätst, sondern es bedeutet nur, dass du der Welt hier draußen eine Chance gibst, sie kennenzulernen“, sagt Leah.
Ich schüttle den Kopf. „Das möchte ich doch gar nicht.“
„Und wieso nicht?“, erkundigt sich Fallon.
„Weil … weil … weil ich Angst habe“, gestehe ich den Frauen ehrlich, die mich mitfühlend ansehen.
Ich habe große Angst davor, mich in ihre Welt zu verlieben. Angst davor, dass sie mich mit offenen Armen empfängt, dass sie mich mit all ihren Farben lockt, ihrem Lärm, ihren Möglichkeiten. Ich habe Angst, dass ich all das will, dass ich mehr möchte.
Aber ich darf nicht.
Ich kann nicht.
Ich habe mich entschieden, habe meinen Weg gewählt. Das Leben im Kloster ist meine Zukunft, meine Passion, meine Bestimmung.
Der Weg Gottes.
Charleen legt mir eine Hand auf die Schulter. „Das verstehen wir. Aber deine Angst sollte nicht darüber bestimmen, wer du bist. Ich spreche da aus Erfahrung.“
Ich spüre, wie meine Kehle enger wird, weil mir plötzlich alles zu viel ist.
„Uns ist bewusst, dass du gerade eine Menge zu verarbeiten hast. Der Angriff im Park, dass du fast vergewaltigt wurdest und nun das hier.“ Charleen hält einen Moment inne und sieht mich mit einer Mischung aus Ernst und Mitgefühl an. „Wenn es jemand versteht, dann ich. Mir ist vor einer Weile etwas ganz Schreckliches passiert. Etwas, das mich fast gebrochen hätte, aber der Club war für mich da. Die Sons of Devil haben mir da rausgeholfen, haben mich unterstützt und aufgefangen. Sie sind meine Familie. Glaub mir, wir wollen dir nichts Böses.“
Ich starre sie an.
Moment mal? Hat sie gerade Sons of Devil gesagt? Söhne des Teufels?
Heilige Mutter Gottes, bitte steh mir bei.
Es wird ja immer schlimmer.
Mein Blick huscht zwischen Fallon und Leah hin und her, die ihre Reaktionen auf meinen sicherlich verstörten Gesichtsausdruck sorgfältig zu verbergen versuchen.
„Glaubst du, dass Cole mich wirklich nur hierbehält, weil er Angst hat, dass ich euch anschwärzen könnte?“, frage ich Charleen.
Sie seufzt. „Wir Frauen werden, zumindest was die Clubangelegenheiten anbelangt, außen vor gelassen. Zu unserem eigenen Schutz. Deshalb kann ich dir deine Frage nicht mit absoluter Sicherheit beantworten, tut mir leid.“
Ich ziehe die Augenbrauen in die Höhe. „Aber ihr seid ihre Frauen. Ich meine, ich bin keine Beziehungsexpertin, aber sollte man in einer guten Partnerschaft nicht offen und ehrlich zueinander sein?“
Leah lächelt mir zu. „Manchmal ist es besser, nicht zu wissen, was los ist. Vertrau mir. Aber sollte es etwas geben, das du wissen musst, wird Cole es dir sagen. Glaub mir, er behält dich nicht hier, um dir wehzutun oder dich zu ärgern, sondern weil er gute Gründe hat.“
Gute Gründe.
Das höre ich ständig, von allen Seiten.
Die Äbtissin hat gute Gründe, mir zu verheimlichen, wer meine Eltern sind. Und nun hat dieser Cole gute Gründe, mich hierzubehalten.
Ich bin kein Kleinkind mehr, das vor allem beschützt werden muss. Ich bin einundzwanzig Jahre alt. Ich bin erwachsen und stark. Stärker als alle zu glauben scheinen.
Aber was bringt mir meine Stärke, wenn ich trotzdem keine Optionen habe?
Ich atme tief durch und lasse meine Schultern sinken. „Mir bleibt wohl keine andere Wahl, als mich mit der Situation zu arrangieren, oder?“
Die Frauen schütteln synchron ihre Köpfe.
Ein resigniertes Lächeln huscht über meine Lippen. „Natürlich nicht.“
„Du wirst schon sehen, so schlimm ist es hier nicht“, sagt Leah.
Sie lächelt mir aufmunternd zu, während die Worte der Frauen in meinem Kopf nachhallen, als hätten sie mir soeben versprochen, dass ein Sprung ins Feuer gar nicht so heiß sei.
„Wenn du dich auf uns einlässt, können wir eine mordsmäßig spaßige Zeit miteinander haben“, meint Fallon.
Mich darauf einlassen … sollte ich? Ich weiß nicht, ob ich das kann.
„Für den Anfang haben wir dir schon mal ein paar Klamotten mitgebracht“, teilt Fallon mir mit. Sie hält eine Tüte in der Hand, die mir bisher überhaupt nicht aufgefallen war. „Ich glaube, dass du dich wohler fühlen wirst, wenn du … normale Kleidung trägst. In deinem Gewand fällst du viel zu sehr auf. Dir wird es wahrscheinlich nicht gefallen, wenn dich alle angaffen. Insbesondere die Clubhuren.“
Mein Herz bleibt stehen.
„Clubhuren?“
„Clubhuren sind Frauen, die sich aus unterschiedlichen Motiven einem Club anschließen. Einige kommen zum Spaß hierher, um eine wilde Zeit mit den Männern zu genießen, andere, um sich des Schutzes des Clubs zu bedienen. Die Frauen stehen den Männern zum Vergnügen zur Verfügung, falls du verstehst, was ich meine“, klärt Leah mich auf.
Meine Kehle schnürt sich zu, mein Magen verkrampft sich.
Herr im Himmel.
Bin ich etwa in einem Freudenhaus gelandet?
Lachend verdreht Charleen die Augen. „Entspann dich, Brooklyn. Niemand zwingt die Frauen dazu, hier zu sein. Es ist allein ihre Entscheidung.“
Fallon kommt auf mich zu und hält mir die Plastiktüte hin. „Zieh dich um, Liebes, anschließend erhältst du von uns eine Führung durch den Club. Vorausgesetzt, dass du aufstehen kannst.“
Ich starre auf die Tüte, dann zu ihr. „Jetzt gleich?“
Grinsend deutet Leah auf eine Tür zu meiner Linken. „Dort drüben befindet sich das Bad, wo du dich in aller Ruhe umziehen kannst.“
Ich werfe einen Blick auf das Gewand, das ich trage. Es hat mich jahrelang in der Öffentlichkeit beschützt, meinen Körper vor der Welt verborgen, mich daran erinnert, wer ich bin. Es ist sozusagen meine Identität.
Und nun soll ich es ablegen?
Im Kloster trage ich in der Regel ganz normale Kleidung – Jeans, T-Shirt oder einen Pullover. Nur zu den Gottesdiensten, an Feiertagen oder wenn wir Besuch erwarten, werfe ich mein Gewand über. Es jetzt abzulegen, kommt mir falsch vor, da die Tracht zum einen die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft betont und zum anderen die Individualität zurücknimmt. Sie zeigt nach außen hin, dass man ein gottgeweihtes, einfaches Leben im Zölibat führt.
Ich starre die Tüte an, dann nehme ich sie mit zittrigen Fingern entgegen und versuche, aus dem Bett zu steigen. Meine Seite schmerzt, und meine Beine fühlen sich wie Wackelpudding an. Mir wird schwindelig, vermutlich, weil mein Kreislauf erst wieder in Schwung kommen muss.
„Gehts?“, erkundigt sich Leah fürsorglich.
„Ich denke schon“, erwidere ich und setze vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um im Badezimmer zu verschwinden.
In der Tüte befinden sich eine Jeans, ein schwarzes Top und eine leichte Strickjacke. Ich schlucke, denn es fühlt sich so an, als würde ich jeden Moment ein Kostüm anziehen – die Verkleidung einer Frau, die ich nicht bin. Natürlich trage ich im Kloster auch weltliche Kleidung, aber eben nicht so freizügige Klamotten wie ein dünnes Top.
Langsam ziehe ich mich um. Jeder Handgriff kommt mir wie ein Verrat an meinem Glauben vor, da die Klamotten viel zu aufreizend sind. Als ich das Top übergestreift und die Jeans über meine Beine gezogen habe, prickelt meine Haut ganz unangenehm. Die Hose ist nämlich wahrlich eng. Sie betont meine Figur. Trotz der Kleidung fühle ich mich nackt und irgendwie verletzlich.
Als ich einen Blick in den Spiegel werfe, halte ich den Atem an.
Ich erkenne mich kaum wieder.
Meine Haare fallen mir in weichen Wellen über die Schultern, meine Augen wirken trotz des Veilchens größer als sonst, und ohne den weiten, fließenden Stoff des Klostergewands sehe ich … anders aus. Fremd. Weltlicher. Sündiger.
Ich schüttle den Kopf und versuche, diese Gedanken zu verdrängen. Das sind bloß Klamotten. Nichts weiter. Sie definieren mich nicht.
Trotzdem fühlt es sich für mich so an, als würde ich etwas verlieren.
Als ich ins Schlafzimmer zurückkehre, werden die Gespräche der Frauen leiser. Sie begutachten mich. Ihre Blicke sagen mehr als tausend Worte.
Leah grinst breit. „Wow, du siehst toll aus.“
Ich ziehe die Strickjacke enger um meinen Oberkörper. „Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.“
„Du siehst wirklich klasse aus“, sagt Charleen. „Komm, wir führen dich rum.“ Sie streckt mir eine Hand entgegen. Zögerlich lege ich meine Finger in ihre und begleite die Gruppe aus dem Schlafzimmer.
Die drei führen mich durch das Gebäude. Es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe – weniger düster, weniger bedrohlich. In der Küche angekommen, bleiben wir kurz stehen.
„Leah kocht hin und wieder für die Jungs“, teilt Fallon mir mit. „Das ist ihre große Leidenschaft.“
Ich nicke.
Wir gehen weiter in den Garten, der sich hinter dem Gebäude erstreckt. Er wirkt wie eine kleine Oase, eingerahmt von hohen Bäumen, die mit ihren ausladenden Kronen Schatten spenden. Bänke und Tische laden zum Verweilen ein, und in der Ecke entdecke ich Spielgeräte für Kinder – eine Rutsche, eine Schaukel, eine Wippe und einen Sandkasten. Ich hätte nicht erwartet, hier so etwas zu sehen. Die Beete sind gepflegt, fürsorglich gehegt.
Nachdem ich den Garten besichtigt habe, betreten wir einen großen Raum mit langen Tischen und schweren Stühlen.
„Hier halten die Männer ihre Versammlungen ab“, erklärt Leah mir. „Wichtige Club-Besprechungen. Frauen haben dabei keinen Zutritt.“
Ich hinterfrage ihre Aussage nicht. Es überrascht mich nicht. Auch im Kloster gibt es Räume, zu denen nur die Priester Zugang haben.
Zum Abschluss des Rundgangs führen mich die Frauen in eine Bar. Überall an den Tischen sitzen Männer mit breiten Schultern, tätowierten Armen und Lederkutten. Ihre Stimmen sind laut und rau. Sie lachen und fluchen. Einige werfen mir neugierige Blicke zu, aber glücklicherweise spricht mich niemand an.
Abrupt bleibe ich stehen, da ich eine Frau entdecke, die auf dem Schoß eines Bikers sitzt und ihn mit einem kessen Lächeln anblickt, während er seine Hand unter ihrem viel zu kurzen Rock verschwinden lässt. Als das Mädchen mein Starren bemerkt, presst sie ihren Mund auf den des Mannes.
„Das ist völlig normal“, meint Leah lachend. „Ignorier sie einfach.“
Ignorieren?
Wie soll das gehen?
Die zwei verschlingen sich, als wären sie füreinander die Henkersmahlzeit.
Ich beiße mir auf die Lippe und frage mich, weshalb Gott mir diese Prüfung auferlegt hat.
Der Lärm in der Bar dröhnt in meinen Ohren und macht mir Kopfschmerzen. Nervös zupfe ich am Ärmel meiner Strickjacke herum. Mein Herz schlägt rasend schnell. Die Luft ist dick vom Zigarettenrauch und dem herben Geruch von Bier. Ich komme mir unendlich fehl am Platz vor.
Charleen lehnt sich gegen den Tresen. „Magst du etwas trinken? Ein Bier oder lieber etwas Stärkeres?“
Ich blinzle. „Alkohol?“ Entschieden schüttle ich den Kopf. „Ich habe noch nie einen Tropfen zu mir genommen. Außerdem habe ich keinen Ausweis bei mir, um zu beweisen, dass ich schon einundzwanzig bin.“
Charleen sieht mich einen Moment lang an, als hätte ich etwas unglaublich Lustiges gesagt, dann lacht sie los. „Du bist wirklich niedlich, Brooki. Hier brauchst du keinen Ausweis. Selbst wenn du noch keine einundzwanzig wärst, würden wir darüber hinwegsehen. Wir halten uns nicht immer an die Gesetze, wir leben nach unseren eigenen Regeln.“
Ihre Worte treffen mich wie ein Schlag.
Natürlich.
Wie konnte ich nur vergessen, wo ich bin? In einem Bikerclub. In einer Welt ohne Ordnung, ohne Strukturen.
Mein Körper wird ganz steif. Abermals wird mir bewusst, dass ich hier nicht hingehöre.
Charleen lehnt sich näher zu mir. „Okay, wie wäre es mit einer Coke oder einer Saftschorle?“
Ich schüttle den Kopf. „Nein, danke. Ich würde lieber wieder auf mein Zimmer gehen. Alle starren mich an. Das behagt mir nicht.“
Ich lasse den Blick durch den Raum schweifen. Sie tun es wirklich. Die mir fremden Männer und Frauen beobachten mich, als wäre ich eine merkwürdige Attraktion.
„Sie gucken, weil du so schön bist.“ Charleen zwinkert mir zu.
Ich schnaube leise. „Ich komme mir so lächerlich vor.“ Das Top, die hautenge Jeans – das bin ganz und gar nicht ich. Ich blicke Charleen flehend an. „Darf ich bitte wieder auf mein Zimmer gehen? Ich bin müde und habe Kopfschmerzen.“
„Natürlich darfst du das. Komm, wir begleiten dich.“
Dankbar folge ich den Frauen durch den Raum. Die Blicke der Anwesenden brennen auf meiner Haut, woraufhin meine Schritte automatisch schneller werden.
Bei meinem Zimmer angekommen, öffnet Leah die Tür und wir treten ein. „Versuch, etwas zu schlafen. Vielleicht war das alles doch ein bisschen viel für dich.“ Sie zieht mich in eine kurze Umarmung, dann lassen mich die Frauen allein.
Ich gehe zum Bett, lege mich hinein und starre die Decke an.
Was mache ich hier nur?
Bis vor ein paar Stunden war meine Welt noch in Ordnung, und nun sitze ich hier fest – an einem Ort, der gänzlich gegensätzlich zu dem ist, was ich gewohnt bin. Harte Biker, laute Stimmen, der Geruch von Leder, Rauch und Benzin. Alles an diesem Ort schreit nach Gefahr, Wildheit, Gesetzlosigkeit. Und das alles nur, weil ich zur falschen Zeit im Park gewesen war.
Wäre ich doch nur nicht allein gegangen. Wenn eine meiner Schwestern mich begleitet hätte, wäre alles anders gelaufen. Dann läge ich jetzt vermutlich im Bett, würde mein Nachtgebet sprechen, vielleicht noch ein paar Seiten lesen und irgendwann selig ins Land der Träume driften. Stattdessen befinde ich mich in einem fremden Gebäude, das sich nach allem anfühlt, nur nicht nach Sicherheit.