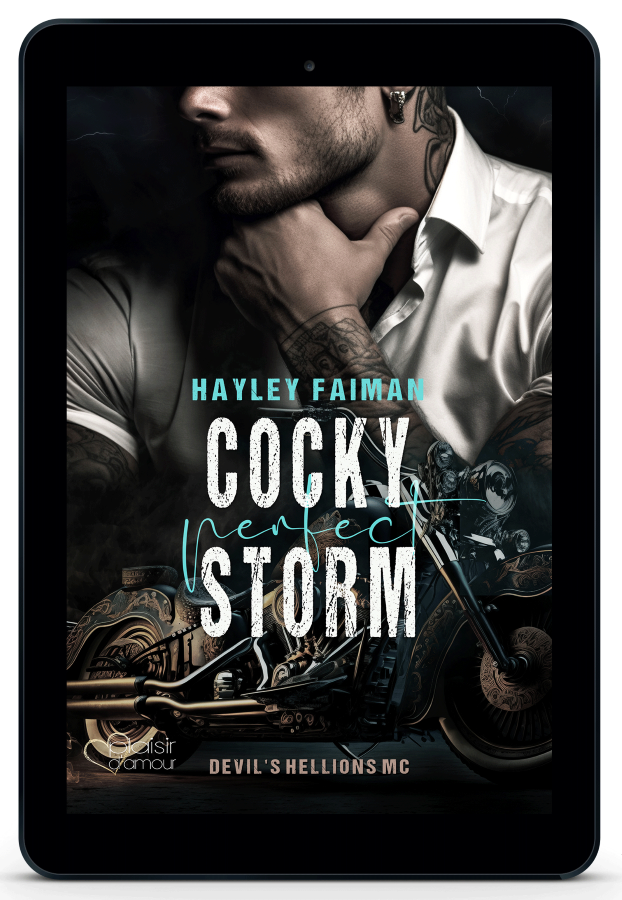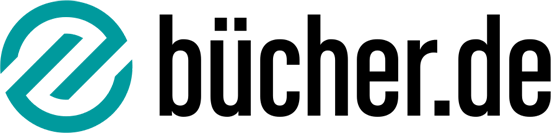Print: 16,90 €[D]
ebook: 6,99 €[D]
Devil's Hellions MC: Cocky Perfect Storm
Hayley Faiman
Inhaltsangabe
Roadkill
Vor Jahren war Kiplyn meine große Liebe, doch eine Intrige trennte uns. Als ich nun im Krankenhaus einen Blick auf das zerschlagene, blutige Gesicht von Kiplyn werfe, weiß ich, dass Kiplyn dazu bestimmt ist, mir zu gehören - für immer. Und dass ich denjenigen töten werde, der ihr das angetan hat.
Kiplyn
Mein Sturm ließ mich beinahe zerbrechen. Roadkill. Er ist genau so, wie ich ihn in Erinnerung hatte, nur besser.
Am Ende frage ich mich, ob er mich rettet - oder ob ich mich selbst rette.
Kiplyns und Roadkills Sturm ist nicht einfach zu überstehen, sondern voller Trauer und Herzschmerz. Ihre Welten prallten einst aufeinander und trennten sich wieder. Aber was einmal war, kann wieder sein, oder?
Über die Autorin
Als Einzelkind musste Hayley Faiman sich mit sich selbst beschäftigen. Im Alter von sechs Jahren begann sie, Geschichten zu schreiben, und hörte nie wirklich damit auf. Die gebürtige Kalifornierin lernte ihren heutigen Ehemann im Alter von sechzehn Jahren kennen und heiratete...
mehr über die Autorin erfahren
Weitere Teile der Devil's Hellions MC Serie
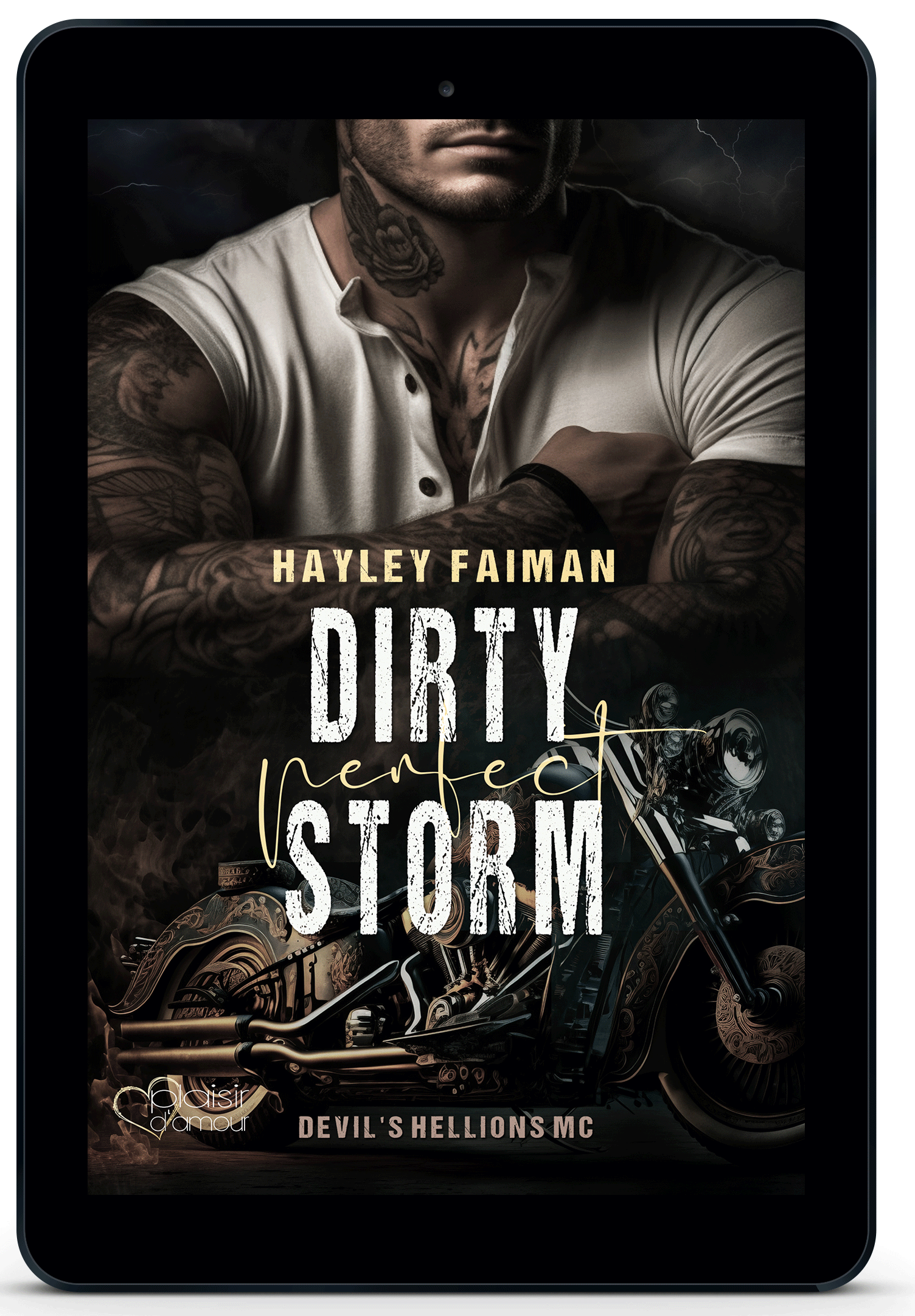
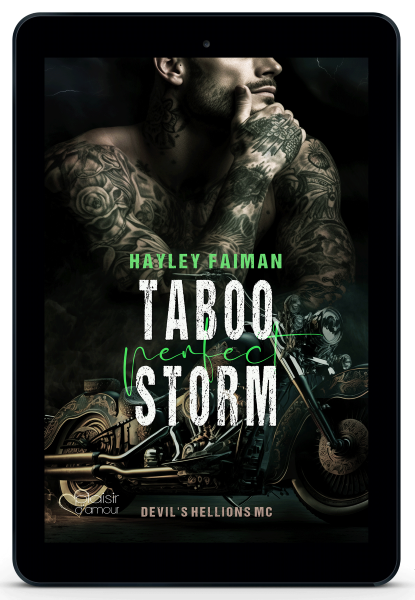

Leseprobe
Kiplyn
Zuerst höre ich ein Piepen, dann ein Knallen. Ich drehe den Kopf zur Seite, öffne die Augen und sehe eine verschwommene Silhouette. Ich kann nicht erkennen, wer es ist. Es ist dunkel im Zimmer, der Geruch von Desinfektionsmittel dreht mir den Magen um und mir wird klar, dass ich im Krankenhaus liege.
„Jetzt hör mir mal zu“, knurrt eine tiefe Stimme. „Ich werde nicht gehen, du lässt mich also besser durch.“
Ich kann nicht hören, was danach passiert, weil die Medikamente anscheinend abermals ihre Wirkung entfalten und meine Augen wieder zufallen, obwohl ich dagegen ankämpfe. Ich will wissen, wer hier...
vollständige Leseprobe
...ist. Mein Herz fängt an zu rasen, wenn ich daran denke, dass es George sein könnte, aber das klang nicht nach ihm.
Das ist mein letzter Gedanke.
Piep. Piep. Piep.
Ich zwinge mich, die Lider zu öffnen, schaue mich verwirrt um und erinnere mich dann, wo ich bin.
Im Krankenhaus.
Ich stöhne und wünschte, ich könnte die vergangenen Stunden – egal, wie viele es letztlich waren – ungeschehen machen und alles ändern. Ich wünschte, ich wäre geflohen, sobald die Scheidung mit George rechtskräftig war. Ich wünschte, ich wäre untergetaucht.
Aber das bin ich nicht.
Ich wollte mutig sein.
Ich wollte stark sein.
Ich wollte furchtlos sein, doch deshalb habe ich mich selbst in Gefahr gebracht. Mehr als das, ich wurde verprügelt. Das trifft es besser. Obwohl ich zehn Jahre lang misshandelt wurde, war es dieses Mal anders. Diesmal ist es nicht passiert, weil ich bei ihm geblieben bin. Es ist passiert, weil ich versucht habe, eine bessere Version meiner selbst zu sein, und das wollte er nicht. Unter keinen Umständen.
„Du bist ja wach“, krächzt eine tiefe Stimme.
Ich zucke leicht zusammen und schaue mich um. Ein Mann sitzt auf einem Stuhl neben meinem Bett, auf Höhe meiner Hüfte. Ich hatte seine Anwesenheit nicht bemerkt. Keine Ahnung, warum, aber ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Das ist völlig untypisch für mich. Während der letzten zehn Jahre war ich immer aufmerksam. Man schärft seine Sinne, wenn man eine Situation wie meine durchlebt. Der Mann sitzt da und beobachtet mich. Sobald ich ihm ins Gesicht sehe, weiß ich, wer er ist.
Eine Narbe zieht sich über seine Wange.
Ich erkenne ihn sofort.
„Rusk?“, frage ich flüsternd.
Er lächelt. Mein Gott, sieht er gut aus. Einfach atemberaubend. Zehn Jahre sind ins Land gegangen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe und die Zeit hat es gut mit ihm gemeint. Offensichtlich besser als mit mir.
„Sag nichts“, meint er sanft.
Dann spüre ich, dass er meine Hand in seine nimmt. Sein Griff ist fest und seine Finger, die er um meine legt, sind warm.
Tränen schießen mir in die Augen.
Ich weiß nicht, warum er hier ist. Ein Teil von mir will, dass er geht, denn obwohl ich weiß, dass er mir so etwas nie angetan hätte, hat er mich trotzdem betrogen und über diesen Schmerz bin ich noch nicht hinweg.
„Wieso?“, frage ich.
Er schüttelt den Kopf, dann beugt er sich leicht nach vorne und berührt meine Finger mit seinem Mund. „Schlaf, meine Süße.“
Dieses Wort. Ich habe es seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Meine Süße. Ich habe es immer geliebt, wenn er mich so genannt hat, vor allem im Bett. Ich habe alles an ihm geliebt. Aber er hat alles kaputt gemacht. Er hat mich angelogen, er hat mich betrogen und ich habe mir geschworen, nie wieder mit ihm zusammen zu sein.
Ich habe mir ein ums andere Mal gesagt, dass ich ihn hasse, und irgendwann habe ich mir selbst geglaubt. Also: Ich hasse diesen Mann.
Offenbar bin ich in keiner besseren Situation als vor zehn Jahren, als ich ihn verlassen habe, wenn man bedenkt, dass ich im Krankenhaus liege, weil mein Ex-Mann mich verprügelt und vergewaltigt hat. Doch deswegen will ich noch lange nicht, dass Rusk mir erneut das Herz bricht.
„Bitte geh“, flüstere ich.
Er lässt meine Hand sofort los, doch er steht nicht auf, um den Raum zu verlassen. Stattdessen neigt er den Kopf und betrachtet mich einen Moment schweigend.
„Nein, meine Süße. Das werde ich nicht.“
„Warum bist du hier? Bist du gekommen, um dich an meinem Unglück zu weiden?“, frage ich.
Er blinzelt und starrt mich überrascht an. Ich war noch nie jemand, der viel redet. Keine dieser kecken, wortgewandten Frauen. Außerdem bin ich gerade ein Wrack und ertrage nichts, nicht einmal meine eigenen Gefühle. Ich will allein sein.
„Mich an deinem Unglück weiden?“, fragt er. Ich muss zugeben, er sieht aufrichtig verwirrt aus. „Meine Süße, ich bin hier, weil du verletzt wurdest. Schwer verletzt. Du bist mir wichtig. Das warst du schon immer.“
Ich atme so tief wie möglich ein – was nicht gut gelingt, weil ich vermutlich ein paar gebrochene Rippen habe – und stoße die Luft langsam wieder aus. Ich versuche, kein Miststück zu sein. Gerade bin ich ziemlich verärgert, und obwohl ich weiß, dass ich das nicht an Rusk auslassen sollte, ist er nun mal gerade hier. Ich bin immer noch verletzt und wütend auf ihn.
Ich hasse ihn noch immer für das, was er mir vor Jahren angetan hat.
„Ich war dir so wichtig, dass du andere Frauen gevögelt hast, während ich zu Hause saß und von Gartenzäunen und Babys geträumt habe? Verschwinde.“
Ich würde am liebsten schreien, aber das kann ich nicht. Rusk steht auf. Er tritt einen Schritt zurück, dann verzieht er die Lippen erneut zu einem Grinsen.
„Fuck“, murmelt er mit süffisantem Lächeln. „Mir gefällt deine Einstellung, Baby.“
Ich kneife die Augen zusammen und schnaube, obwohl das höllisch wehtut. „Dir gefällt die missbrauchte Frau, die körperlich und psychisch erschöpft und völlig am Ende ist? Wow.“
Sofort verschwindet das Lächeln aus seinem Gesicht und er reißt die Augen auf. Dann schüttelt er vehement den Kopf. „Das ist nicht fair. Und das bist du nicht.“
Er hat recht, das bin ich wirklich nicht, aber das werde ich jetzt keinesfalls zugeben. Ich sage nichts. Er tritt einen weiteren Schritt zurück, dann geht er langsam auf die Tür zu. Doch anstatt sie zu öffnen, dreht er den Kopf und schaut mich über die Schulter an.
„Ich werde nicht gehen, Kiplyn. Ich warte draußen.“
„Warum?“, frage ich.
„Weil ich dich schon einmal gehen lassen habe. Ich habe es verkackt und das werde ich nicht noch einmal tun. Ich bleibe hier, meine Süße.“
Nachdem er diese Bombe platzen lassen hat, öffnet er die Tür, spaziert hinaus und lässt mich allein zurück. Die Tränen, die ich vor wenigen Minuten noch unterdrücken konnte, brechen nun aus mir heraus.
Ich will nicht heulen, aber ich kann nichts dagegen tun.
Die letzten zehn Jahre blitzen vor meinem inneren Auge auf. Rusk und George, dann George und sein Missbrauch. Ich wünschte, ich wäre bei Rusk geblieben, obwohl ich weiß, dass auch er mich zerstört hätte, wenn auch auf eine andere Weise. Es dauert nicht lang, bis ich völlig erschöpft wieder in den Schlaf sinke.
Kiplyn
Zwei Tage später
„Dieser süße Typ wartet immer noch vor Ihrem Zimmer. Sind Sie sicher, dass Sie ihn nicht hereinlassen wollen?“, fragt die Krankenpflegerin mich zum tausendsten Mal.
Beinahe fordere ich sie auf, sich doch selbst um ihn zu kümmern, wenn sie ihn so süß findet. Aber ich wäre wirklich eifersüchtig, wenn die beiden auf die Idee anspringen würden, weshalb ich nur lächelnd den Kopf schüttle. Heute darf ich nach Hause.
Allein.
Ich habe keine Ahnung, ob ich es bis über meine Türschwelle schaffe, aber das werden wir dann sehen. Besser gesagt, das werde ich dann sehen. Es wird ja sonst niemand bei mir sein. Die Krankenpflegerin räuspert sich und lächelt mich mitleidig an.
„Sind Sie sicher, dass Sie nicht wollen, dass die Polizei herkommt und Ihre Aussage vor Ort aufnimmt?“, fragt sie. „Sie waren bereits hier und haben den Bericht angefangen, aber es wäre einfacher, wenn sie Sie einfach hier befragen könnten.“
Ich weiß ihren Versuch, mir zu helfen, wirklich zu schätzen. Aber ich habe keine Lust, in diesem Krankenhausbett zu sitzen und meine Aussage zu Protokoll zu geben. Ich muss auf eigenen Beinen die Polizeiwache betreten und Anzeige erstatten.
„Darum kümmere ich mich in ein paar Tagen“, sage ich. „Ich will selbst dort hingehen. Das brauche ich.“
Sie wirft mir einen Blick voller Mitgefühl zu, oder vielleicht auch Mitleid, dann überreicht sie mir einen Stapel Papiere. „Wenn Sie je Hilfe brauchen, finden Sie hier drin die nötigen Informationen. Bitte zögern Sie nicht, sich zu melden. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn Sie mit jemandem reden. Das macht sie stärker.“
Ihre Worte sind lieb gemeint. Ich bin mir sicher, dass sie das auswendig gelernt hat, aber es ist trotzdem nett von ihr. Ich lächle sie an, dann nicke ich, nehme die Dokumente entgegen und lege sie auf meinen Schoß. Ich klammere mich an ihnen fest, als hinge mein Leben davon ab.
Als die Tür aufgeht, fahre ich zusammen. Ein Arzt betritt den Raum und wirft einen kurzen Blick auf meine Unterlagen, bevor er vor mir stehenbleibt. Er hebt den Blick, schaut mir in die Augen und lächelt.
„Bereit, nach Hause zu gehen?“, fragt er.
Wortlos nicke ich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich will ganz und gar nicht nach Hause, aber ich will auch nicht länger hierbleiben. Alles, was ich ihm erwidern kann, ist also ein Nicken und ein angespanntes Lächeln.
Glücklicherweise stellt er keine Fragen sondern überreicht mir nur ein Rezept für Schmerz- und Schlafmittel, die ich in der Apotheke holen soll.
„Denken Sie daran, dass die Schlafmittel nur einmal ausgegeben werden.“
Ich fahre mit der Zunge über meine immer noch geschwollene und geplatzte Unterlippe und nicke erneut. „Danke“, sage ich matt.
„Passen Sie auf sich auf, Ms. Robbins.“
Er verlässt den Raum und lässt mich mit der Krankenpflegerin allein. Sie räuspert sich und lächelt mich an. „Bereit?“
„Ja.“
Mühsam stehe ich auf. Ich trage nur einen Kittel und ein paar dicke Socken, weil meine Kleidung genau wie meine Schuhe zu Beweiszwecken einkassiert wurde. Außerdem trage ich weder BH noch Slip. Es ist das seltsamste Gefühl überhaupt.
Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Schließlich bin ich nicht eigenständig hierhergefahren. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich hierhergekommen bin. Ich bin einfach nur froh, dass ich es irgendwie geschafft habe. Trotzdem ist mein Zuhause etwa eine Stunde von hier entfernt und ich habe keine Möglichkeit, dorthin zu kommen.
Allerdings mache ich mir darüber keine Gedanken. Wenn ich hundert Dollar für ein Uber hinblättern muss, dann ist das eben so. Ich werde einfach nach Hause fahren, mich ausruhen und dann aus dieser Stadt verschwinden. Das hätte ich schon längst tun sollen.
Meine Eltern wohnen nicht mehr hier. Sie sind wegen der Arbeit meines Vaters nach Nordkalifornien gezogen und dort gefällt es ihnen so gut, dass sie nicht zurückkommen werden. Ich bin Einzelkind, es hätte ihnen also eigentlich schwerfallen müssen, mich zurückzulassen, aber das war nicht der Fall. Zu dem Zeitpunkt hatte George mich bereits von der Außenwelt isoliert, also sind sie einfach fortgezogen und nicht zurückgekommen.
Ich habe mehrmals erwägt, sie zu besuchen, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung irreparabel zerrüttet ist. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Die mache ich noch immer. Nein. Zuerst muss ich mein Leben auf die Reihe kriegen, dann kann ich mich um meine Freunde und Familie kümmern. Besser gesagt nur um meine Familie, denn Freunde habe ich keine. Obwohl, eine Freundin ist mir geblieben: Reese.
Die Krankenpflegerin geht auf die Tür zu und ich folge ihr. Kaum zu glauben, wie schwer es mir noch immer fällt, zu gehen. Es tut nicht nur dort weh, wo ich vergewaltigt wurde. Das bin ich von George leider gewohnt. Der ganze Körper schmerzt, einfach alles.
Sogar meine Haare tun weh.
„Oh, hallo“, ruft die Krankenschwester mit hoher, quietschender Stimme.
Ich drehe den Kopf und blinzle, als ich Rusk entdecke, der an der Wand gegenüber lehnt. Er stößt sich ab und kommt auf mich zu. Er bleibt erst stehen, als er direkt neben mir ist, als ob das sein Platz wäre. So ungern ich das auch tue, ich muss zugeben, dass es mir gefällt, ihn an meiner Seite zu haben. Als er mir den Arm um die Taille legt, schnappe ich nach Luft.
„Bitte nicht“, wispere ich.
Er schnaubt. „Du brauchst Hilfe, meine Süße, und ich werde nicht von deiner Seite weichen.“
Ich will gerade den Mund öffnen und ihn zum Teufel jagen, doch dann überlege ich es mir anders und presse die Lippen aufeinander. Ich habe zwar meinen Stolz, aber mir ist bewusst, dass ich wirklich Hilfe brauche. Selbst, wenn es nur bis zum Parkplatz ist. Wortlos führt die Krankenpflegerin uns zum Ausgang des Krankenhauses.
Sobald wir draußen sind, wendet sie sich Rusk zu und spricht mit ihm, als wäre ich überhaupt nicht anwesend. „Sollten Sie je Hilfe brauchen, können Sie mich gerne jederzeit anrufen. Ich habe meine Handynummer auf den Dokumenten notiert.“
Ich antworte ihr gar nicht erst, weil mir klar ist, dass diese Worte ausschließlich für Rusk bestimmt waren. Was für ein Miststück. Sie flirtet tatsächlich ungeniert vor meinen Augen mit ihm. Nicht, dass wir zusammen wären, aber hallo? Im Ernst?
Die Krankenpflegerin klimpert mit den Wimpern, dann dreht sie sich um und marschiert wieder zurück ins Krankenhaus. Ich nehme an, dass sie dabei extra verführerisch mit dem Hintern wackelt. Ich drehe mich nicht nach ihr um. Ehrlich gesagt macht mir das nichts aus, weil ich ihn hasse.
Nein, das ist gelogen.
Es macht mir etwas aus und ich würde ihr am liebsten die Haare ausreißen, obwohl ich kein Recht dazu habe und eigentlich Rusk derjenige ist, den ich hasse. Ich hasse ihn wirklich. Und ich beschließe, dass ich mir das selbst so oft vorbeten werde, bis ich vergesse, wie sehr ich ihn einmal gemocht, nein, geliebt habe.
„Danke, dass du mich hinausbegleitet hast. Du kannst jetzt gehen.“
Rusk schnaubt. „Wovon zum Teufel redest du, Baby?“
„Danke, dass du mich hinausbegleitet hast, aber du kannst jetzt nach Hause gehen“, wiederhole ich.
Er zieht eine Augenbraue hoch, grinst mich an und kichert. „Nein“, widerspricht er.
Ich öffne den Mund, um ihm erneut zu sagen, dass er sich verziehen soll, doch er kneift die Augen zusammen und schüttelt den Kopf. „Sag jetzt nichts mehr“, fordert er energisch. „Rühr dich nicht vom Fleck.“
Seine Worte durchfahren meinen Körper und ich richte mich auf. Ich weiß nicht, wieso, aber ich befolge seinen Befehl. Ich sehe zu, wie er davoneilt und bleibe, wo ich bin. Hauptsächlich, weil es zu schmerzhaft wäre, mich zu bewegen. Er eilt über den Parkplatz, steigt in einen roten Wagen ein und lässt den Motor an. Ich höre, wie er aufheult, bevor er losfährt.
Ich kann die Augen nicht von dem roten Auto losreißen und schnappe nach Luft, als er über den Parkplatz auf mich zugefahren kommt.
Eine Chevelle von 1970.
Eine rote Chevelle.
Dieselbe wie die, die er hatte, als wir noch zusammen waren.
Mir bleibt das Herz stehen.
Allein das Geräusch des Motors lässt unzählige Erinnerungen auf mich einstürmen. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ich weiß wirklich nicht, ob ich auf dem Beifahrersitz Platz nehmen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Herz das auch nur eine einzige Sekunde lang aushält.
Mein Gott, zehn Jahre sind vergangen und es fühlt sich an, als hätte er mich gestern mit seinem Wagen für ein Date abgeholt. Ich will heulen. Ich will schreien. Ich will ihm vergeben, obwohl er mich nicht darum gebeten hat.
Ich will. Ich will. Ich will.
Ich will alles und zugleich nichts.
Roadkill
Ich bin mir sicher, dass ich etwas sagen sollte, aber ich schweige. Es würde gerade ohnehin nichts bringen. Stattdessen konzentriere ich mich also darauf, zu fahren. Sie ist wütend auf mich und das bringt mich zum Lächeln, obwohl es das nicht sollte.
Zehn Jahre ist es her und dennoch fühle ich mich siegessicher.
Aus einem einfachen Grund: Sie ist auch zehn Jahre später immer noch sauer auf mich. Das heißt, dass sie immer noch etwas für mich empfindet, anstatt nichts für mich zu fühlen. Es herrscht Stille im Auto, nur im Hintergrund läuft leise das Radio, natürlich mit Rockmusik.
Sie räuspert sich, um mir anschließend eine Frage zu stellen, mit der ich nicht gerechnet habe. „Warum sind deine Fingerknöchel verletzt und geschwollen?“
Ich kann ihr unmöglich die Wahrheit sagen, will sie aber auch nicht anlügen, also wechsle ich einfach das Thema. „Ich nehme an, dass du nicht mehr mit George zusammenlebst. Ich habe keine Ahnung, wo du jetzt wohnst. Willst du mir deine Adresse nennen?“
Sie spricht nicht sofort. Stöhnend verlagert sie ihr Gleichgewicht auf dem Beifahrersitz, dann lässt sie vorsichtig den Kopf nach hinten fallen und antwortet schließlich. Als ich höre, in welcher Straße sie wohnt, reiße ich die Augen auf.
Ich komme aus Casa Grande und habe schon überall in dieser Scheißstadt gewohnt. Ich weiß genau, was ihr Viertel für eine Gegend ist. Aber sie weiß das genauso gut. Schließlich sind wir dort aufgewachsen.
„Baby“, knurre ich. „Du lebst in einem beschissenen Stadtteil.“
Sie lacht laut auf, klingt aber alles andere als amüsiert.
„Denkst du etwa, ich schwimme in Geld? Glaubst du, ich hätte überhaupt Kohle? Es kostet mich schon unsägliche Mühe, dieses Haus in diesem Teil der Stadt zu bezahlen. Es ist wortwörtlich das Beste, was ich mir gerade leisten kann. George hat mir alles genommen und es entweder versoffen oder sich in die Nase gezogen. Vielleicht hat er es auch für Nutten ausgegeben, keine Ahnung.“
Wenn ich könnte, würde ich ihn am liebsten noch mal zu Hackfleisch machen. Bevor ich sein Haus verlassen würde, würde ich sicherstellen, dass er mausetot ist, denn gerade bereue ich es, ihn nicht erledigt zu haben. Eigentlich habe ich keinen Schimmer, ob er tot oder am Leben ist.
Ich umklammere das Lenkrad, bis ich meine Finger knacken höre und den Griff lockere, denn ich will mir die Fahrt mit Kiplyn nicht von diesem Arschgesicht versauen lassen.
„Du kannst unmöglich allein dort bleiben“, belle ich.
Kiplyn schweigt. Stille breitet sich wieder aus, doch dieses Mal durchbreche ich sie nicht. Ich bin stinksauer. Ich fische mein Handy aus der Innentasche meiner Kutte, suche Legacys Nummer, drücke die Wähltaste und lege mir das Handy ans Ohr.
„Du darfst nicht telefonieren, während du fährst, Rusk. Das ist in Arizona mittlerweile verboten“, meckert Kiplyn neben mir.
Ich werfe ihr einen kurzen Blick zu, dann wende ich meine Aufmerksamkeit wieder der Straße zu und ignoriere sie.
„Bruder“, meldet sich Legacy.
„Ich muss den Wichser finden und ins Clubhaus bringen. Und ich brauche jemanden, der die ganze Zeit bei Kiplyn bleibt. Überwachung rund um die Uhr.“
„Du weißt, was das bedeutet?“, fragt Legacy.
Er muss das Schlagwort hören. Das kann ich verstehen, aber verdammt, sie war von Anfang an meine Old Lady. Das konnte ich bislang nur nicht laut aussprechen. Ich dachte, ich könnte sie aus allem raushalten, aber nachdem ich gesehen habe, was mit Legacy und Henli passiert ist, weiß ich, dass das nicht möglich ist. Nicht, wenn ich sie ganz für mich haben will. Nicht, wenn ich sie in Sicherheit wissen will. Nicht, wenn ich sie vor der Außenwelt beschützen will.
Dafür gibt es nur einen Weg und ich weiß, was zu tun ist.
Ich muss sie für mich beanspruchen.
„Sie ist meine Old Lady“, sage ich ins Handy.
„Nicht deine Citizen Wife außerhalb vom Club?“, fragt Legacy.
Ich antworte nicht sofort und würde am liebsten das Handy aus dem Fenster schmeißen und es zertrümmern, denn dieser Arsch macht es mir absichtlich schwer.
„Das war sie schon mal und ich will es nicht noch einmal so handhaben. Ich beanspruche Kiplyn hier und jetzt als meine Old Lady.“
„Dann bekommt sie auch alle Vorteile einer Old Lady. Ich erstelle sofort einen Zeitplan für die Prospects.“
Ohne mich zu bedanken oder sonst etwas zu sagen, lege ich auf. Ich werde mich heute Abend persönlich mit ihm unterhalten. Gerade konzentriere ich mich auf die Aufgabe, die Frau neben mir nach Hause zu bringen und dafür zu sorgen, dass sich jemand um sie kümmert. Fuck. Ich habe keine Ahnung, wer auf sie aufpassen könnte. Ich weiß, dass ich definitiv nicht der Richtige dafür bin, das Tag und Nacht zu tun. Es wäre mir unmöglich, mich richtig zu verhalten.
„Will ich wissen, worum es in diesem Gespräch ging? Ihr habt über mich gesprochen“, stellt sie fest.
Ich erwidere nicht sofort etwas darauf und frage mich, wie ich es ihr beibringen kann, ohne sie zu verärgern, doch dann muss ich prusten, weil das schlicht unmöglich ist. Sie wird so oder so an die Decke gehen.
„Ich habe dich soeben als meine Frau, als meine Old Lady beansprucht“, verkünde ich.