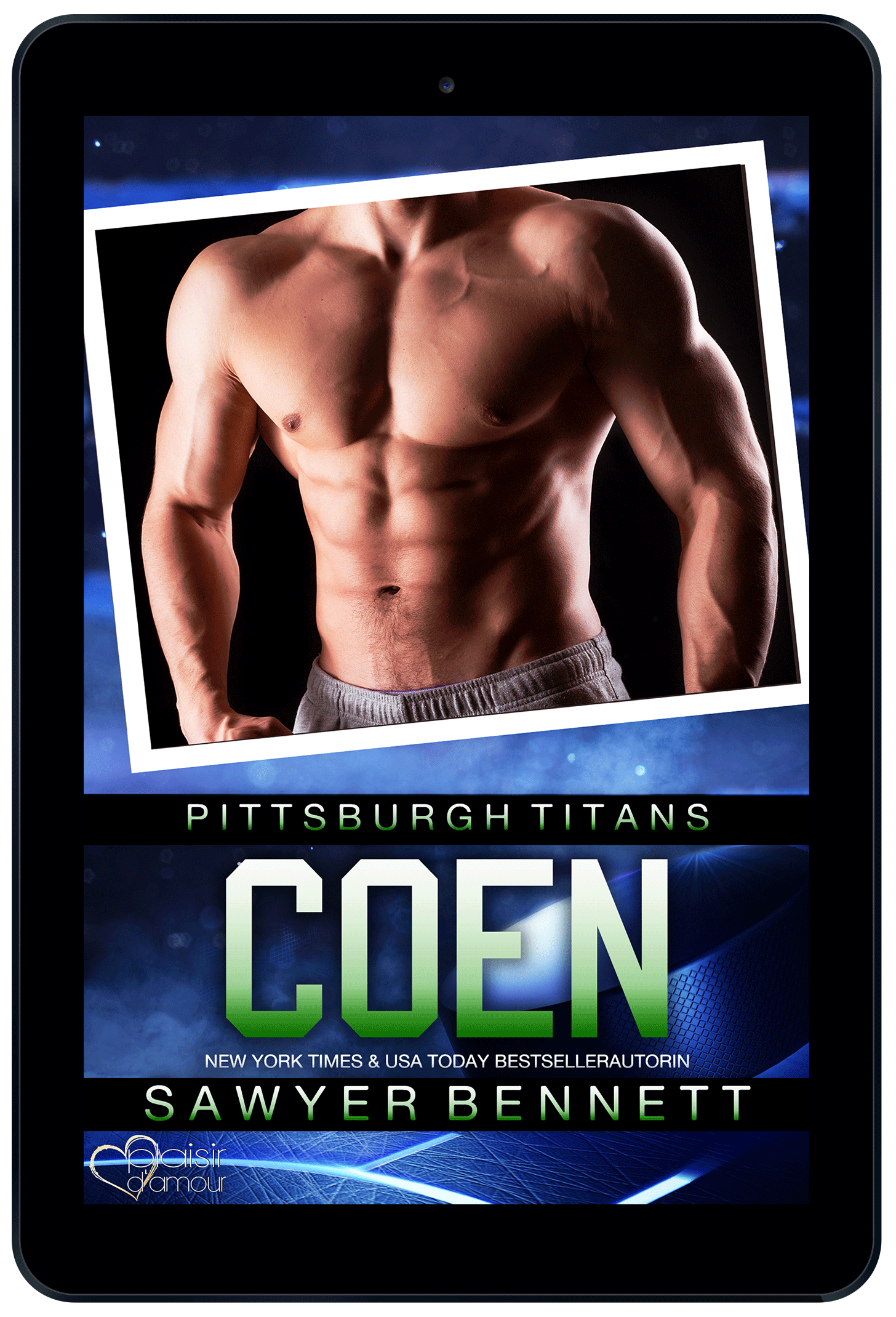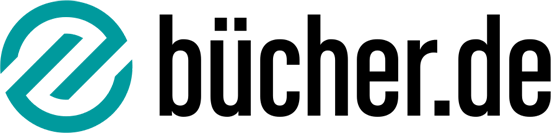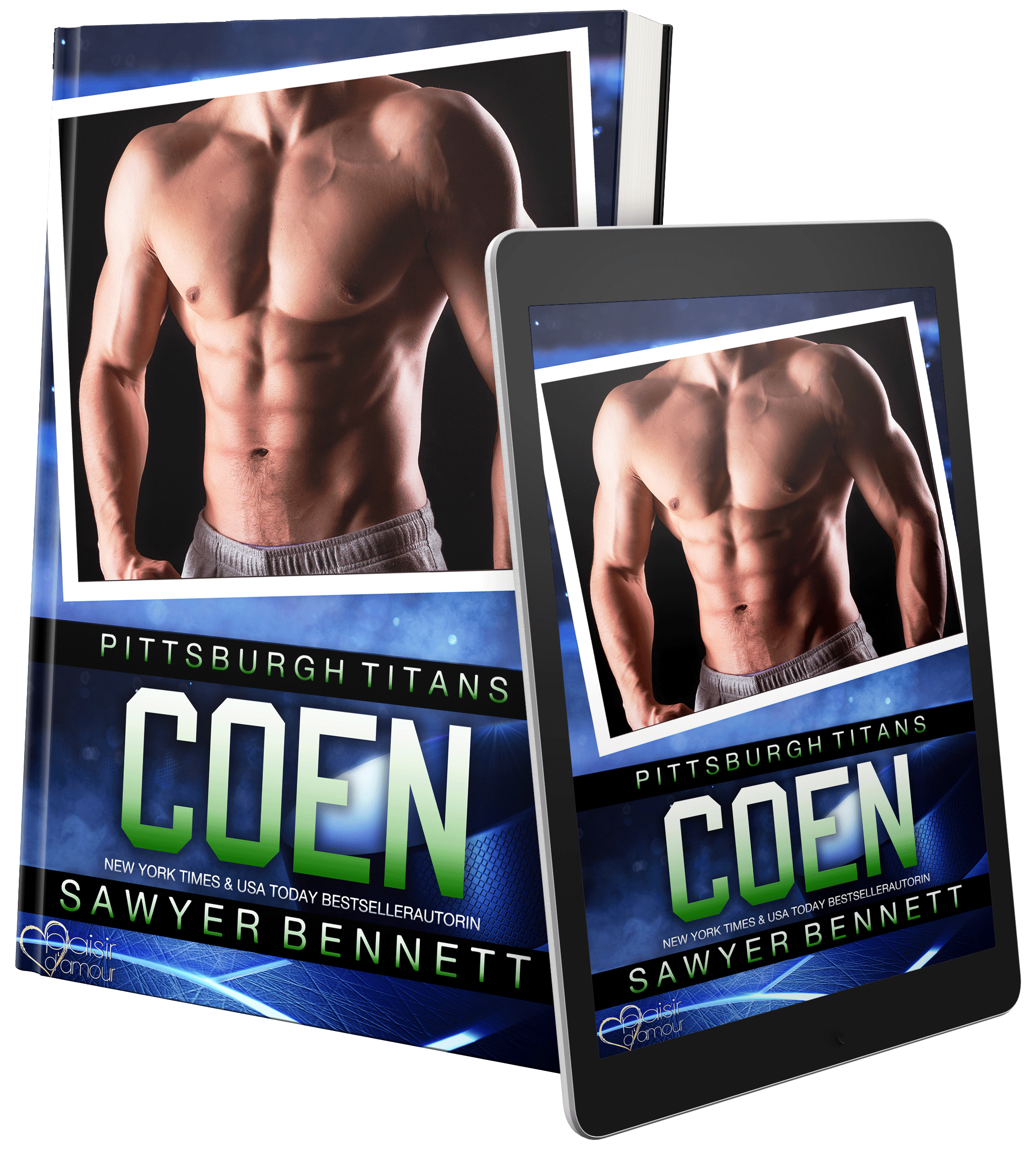
paperback & ebook
Print: 978-3-86495-620-1
ebook: 978-3-86495-621-8
Print: 16,90 €[D]
ebook: 6,99 €[D]
Pittsburgh Titans: Coen
Sawyer Bennett
Inhaltsangabe
Coen Highsmith war ein Ligastar, aber er verlor mehr als sein Team an dem Tag, an dem das Flugzeug der Pittsburgh Titans abstürzte. Kann er aus seiner Abwärtsspirale aus Schuld und Bedauern gerettet werden, um der Mann zu werden, der er einmal war?
Ich hatte alles – eine erfolgreiche Eishockeykarriere, den Respekt und die Bewunderung der Fans und viele schöne Frauen, die mein Bett wärmten. Aber das änderte sich an dem Tag, an dem das Teamflugzeug abstürzte. Jetzt bleibt mir nur die tägliche Erinnerung an all meine Fehler.
Meine neuen Teamkollegen haben meine schlechte Einstellung satt und nach meiner Suspendierung verkrieche ich mich in einer Berghütte, um dem ganzen Trubel zu entfliehen. Die Isolation ist genau das, was ich brauche, und ich könnte mit dieser Stille für immer zufrieden sein.
Tillie Marshall ist nicht der Typ Frau, der normalerweise meine Aufmerksamkeit erregen würde - aber sie schafft es aus den falschen Gründen. Die schrullige Künstlerin fällt nämlich die Bäume zwischen unseren Grundstücken, damit sie ein Töpferstudio eröffnen kann. Wenn sie Krieg mit mir will, kann sie ihn bekommen!
Leider erzeugt diese nervtötende Nachbarin noch ein ganz anderes Gefühl in mir. Und als der Funke erst einmal übergesprungen ist, zeigt Tillie ein Vertrauen in mich, an das ich zum ersten Mal seit dem Unfall verzweifelt glauben möchte. Jetzt ist es an der Zeit für mich, ein besserer Mann zu werden, als ich es einst war.
Über die Autorin
Seit ihrem Debütroman im Jahr 2013 hat Sawyer Bennett zahlreiche Bücher von New Adult bis Erotic Romance veröffentlicht und es wiederholt auf die Bestsellerlisten der New York Times und USA Today geschafft.
Sawyer nutzt ihre Erfahrungen als ehemalige Strafverteidigerin in...
mehr über die Autorin erfahren
Weitere Teile der Pittsburgh Titans Serie


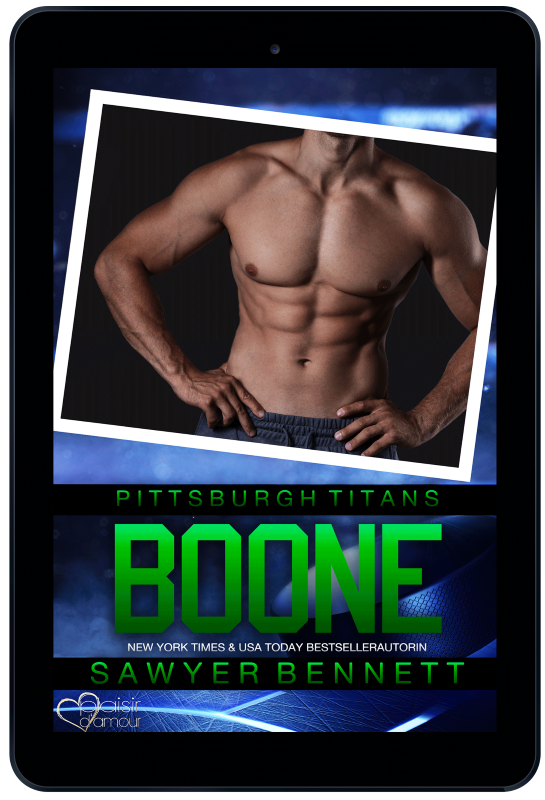
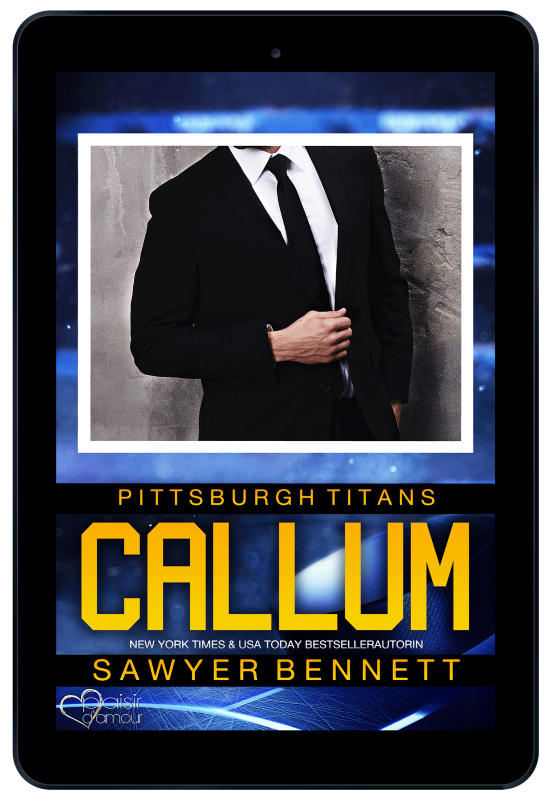
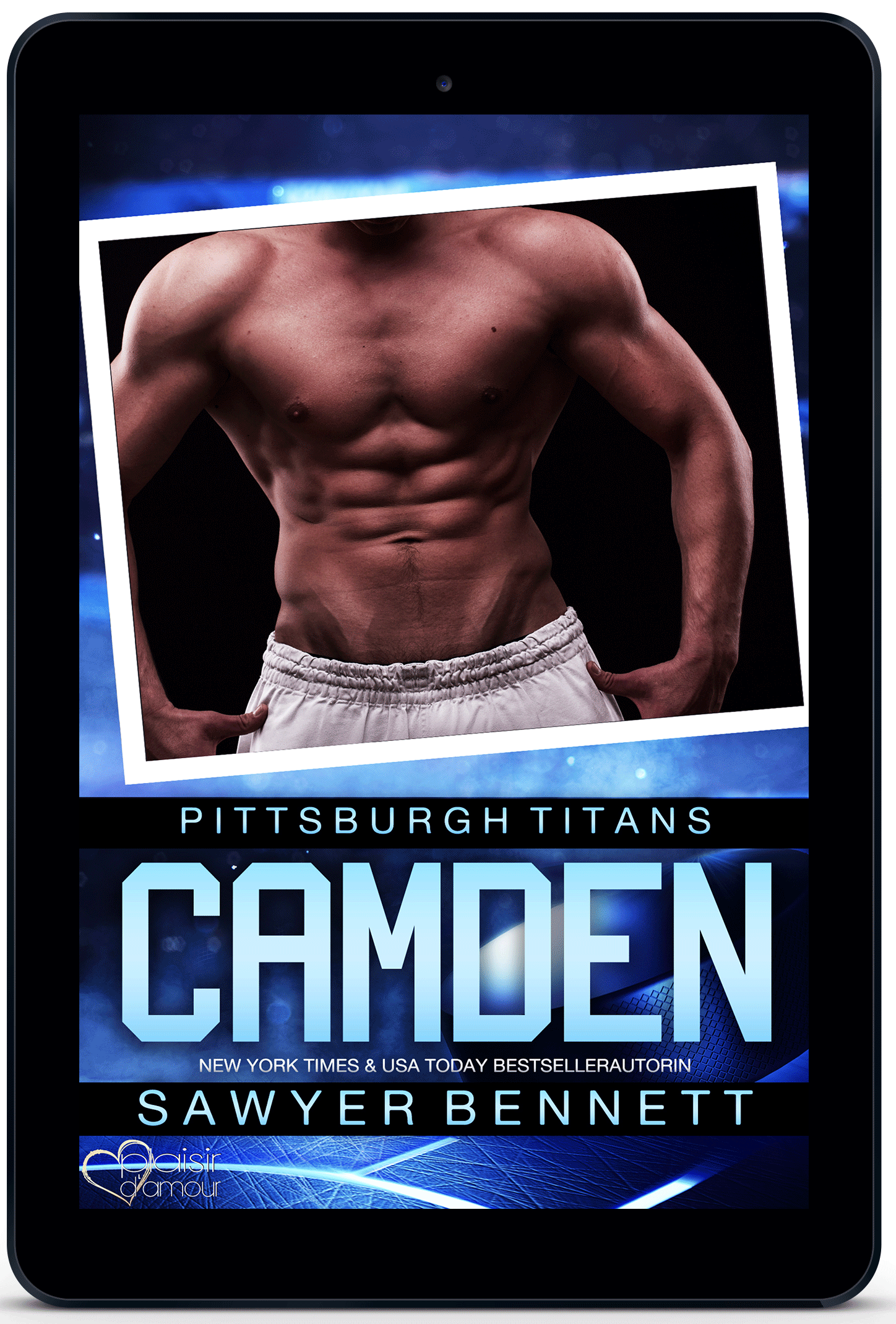
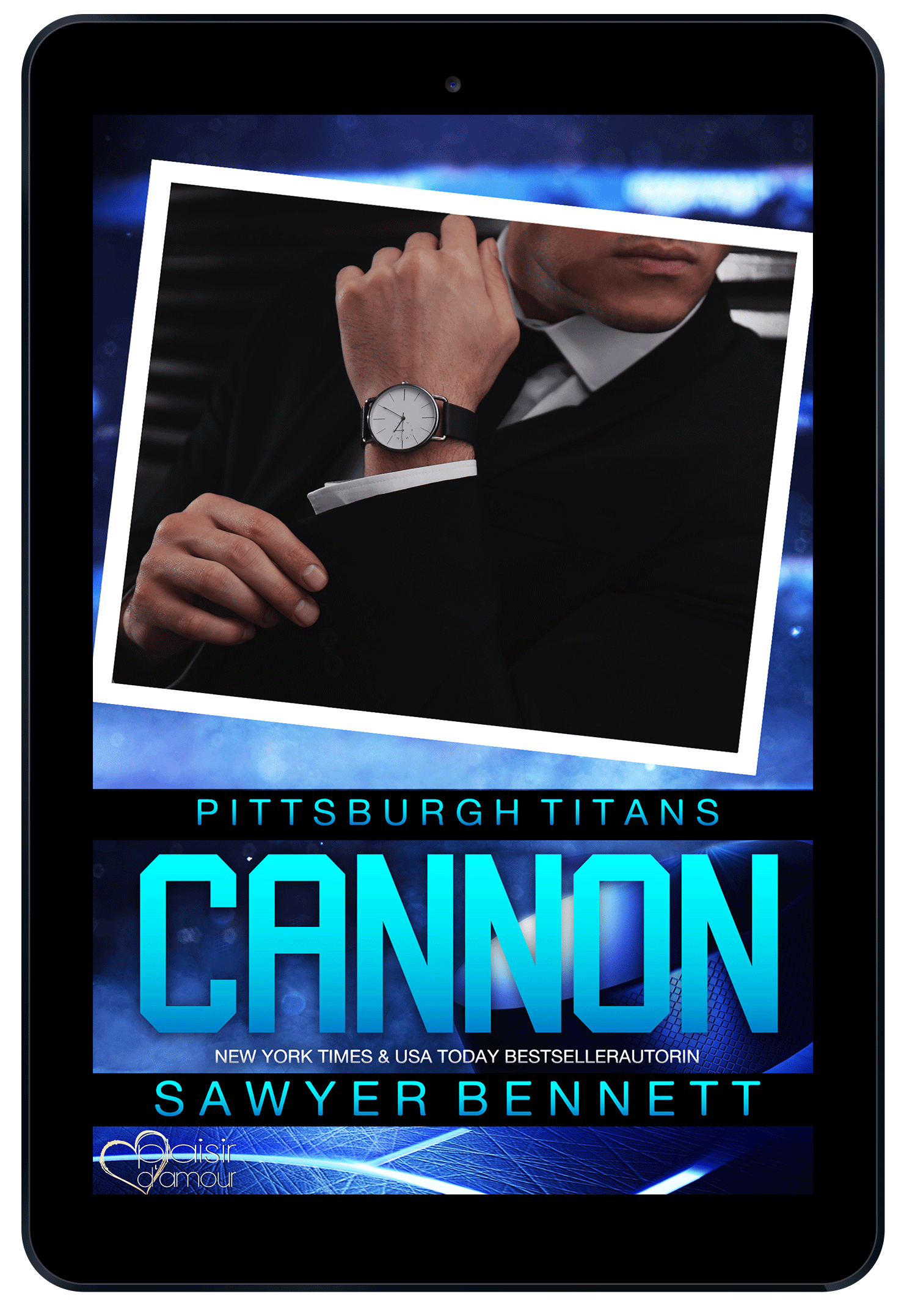
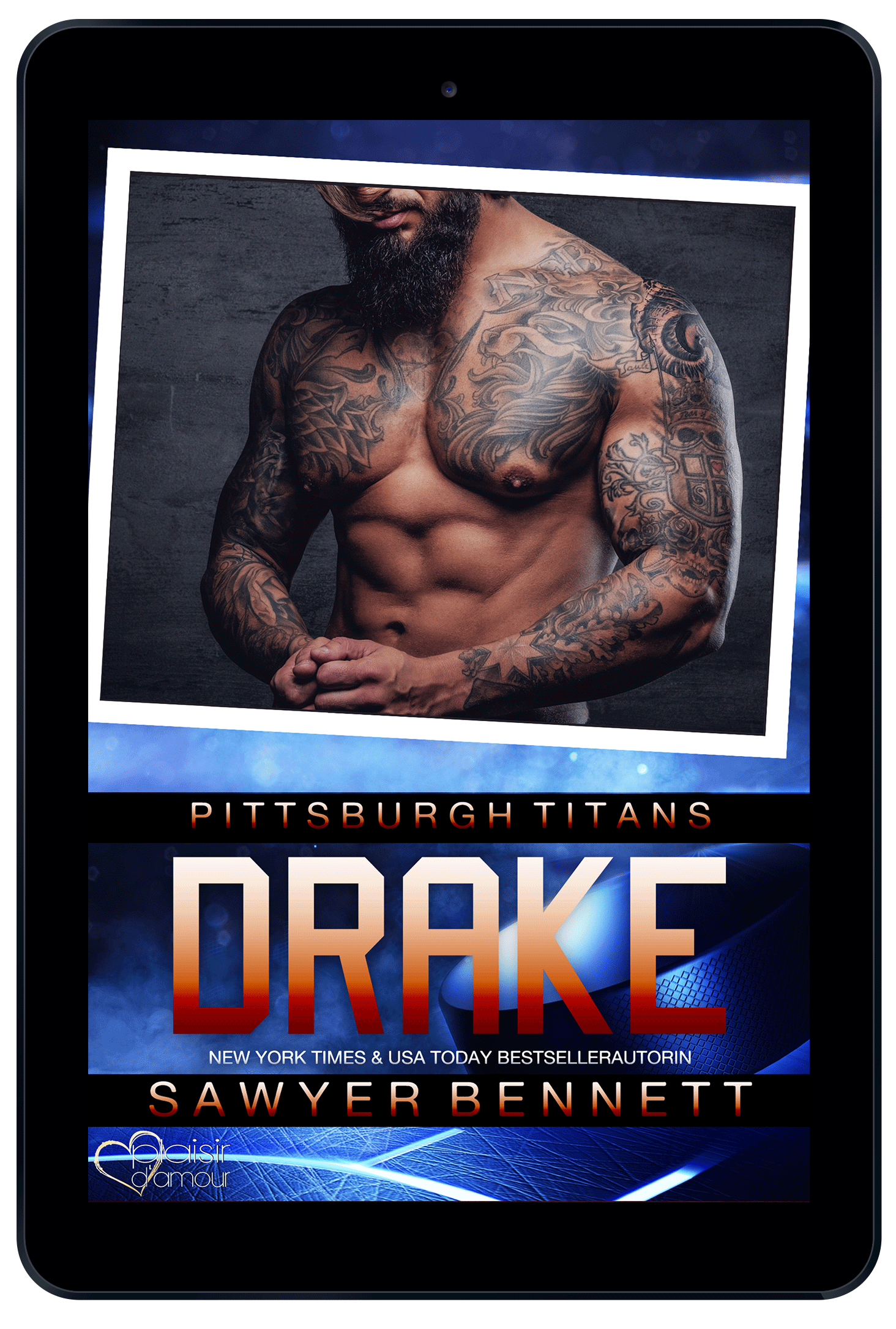
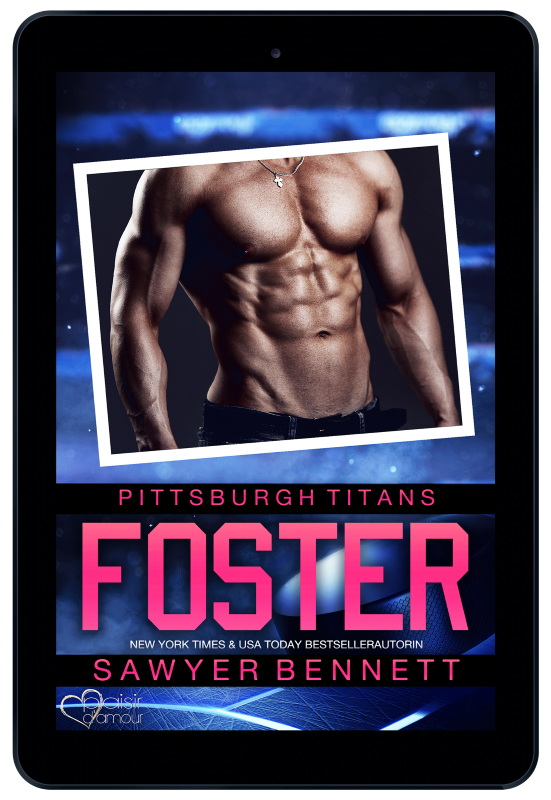

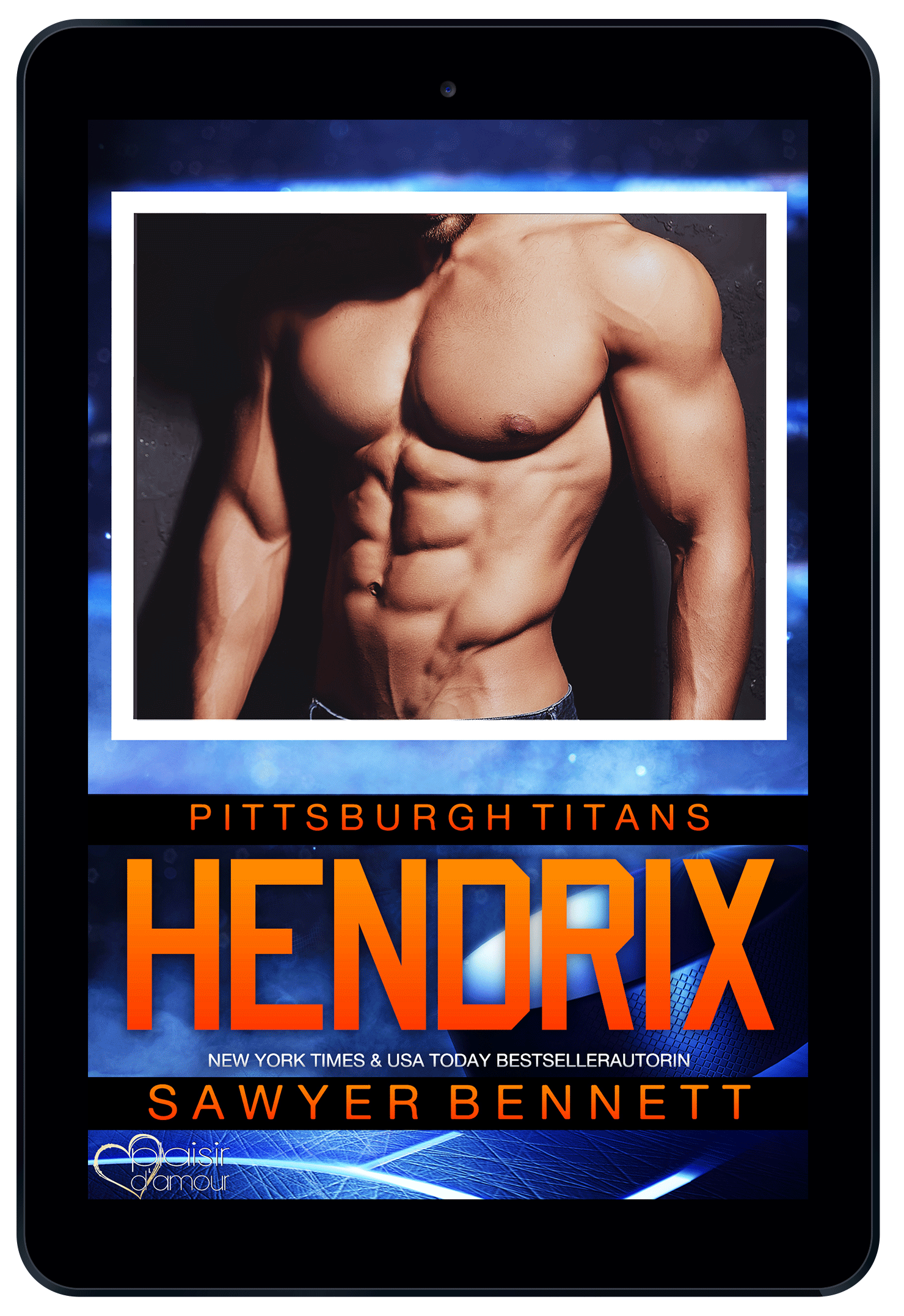
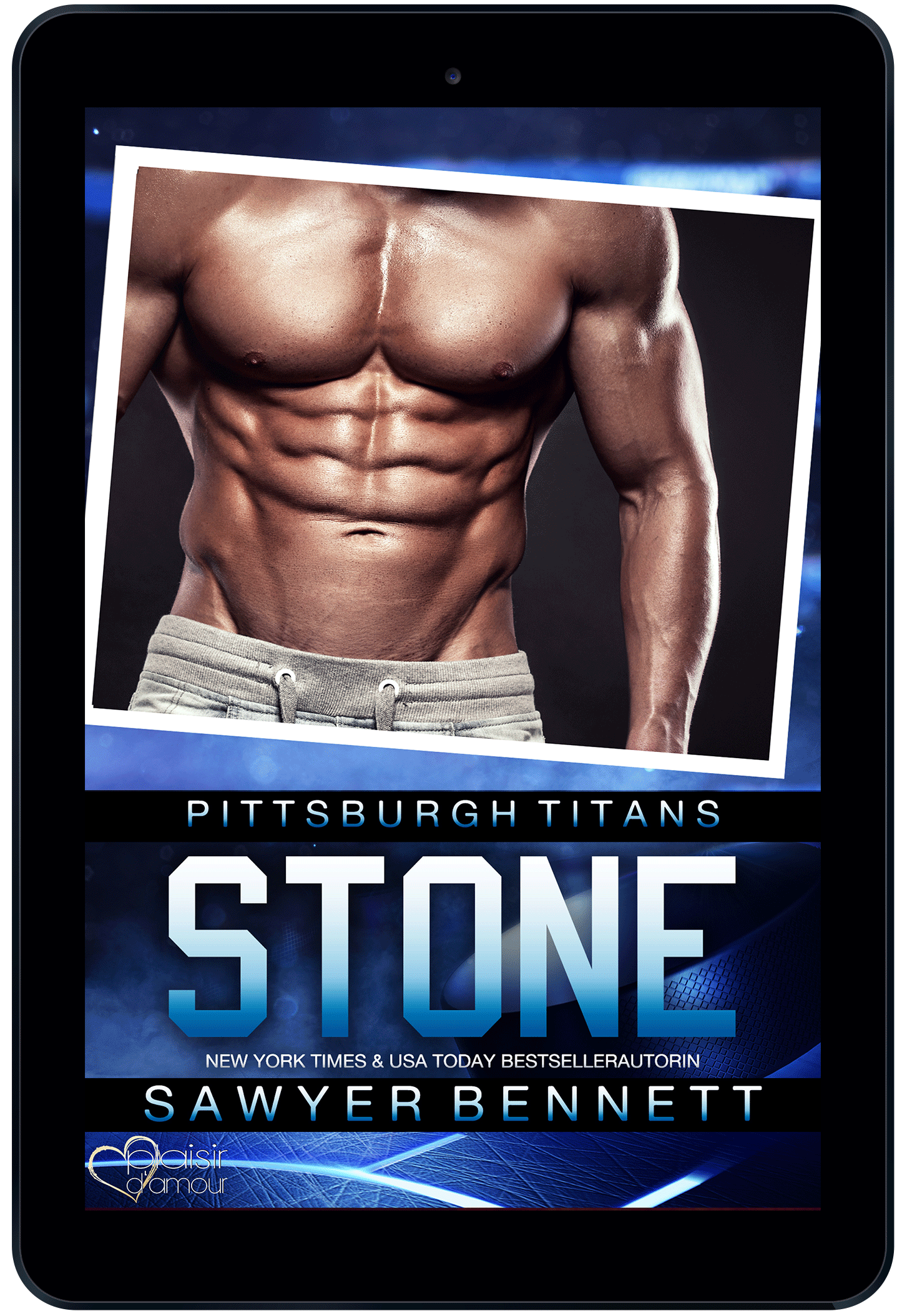

Leseprobe
Tillie
Ich schmolle den ganzen Heimweg über und frage mich, wie viel Rechtsanspruch dieser Mann hat, mein Nutzungsrecht zu stoppen. Ich habe alles nach Vorschrift gemacht. Ich habe das Grundstück für eine kommerzielle Nutzung umgewandelt, was hier im ländlichen West-Pennsylvania für die meisten Menschen nicht infrage käme. Ich habe zwar vor, in meinem Studio Kunst zu verkaufen, aber es ist vor allem ein Ort, an dem andere angehende Künstler arbeiten und lernen können. Es wird kein belebtes kommerzielles Einkaufszentrum sein.
Als ich um eine Ecke biege, kommt meine eigentliche Einfahrt immer näher. Nur noch eine Kurve, und dann erreiche ich hundert...
vollständige Leseprobe
...Meter weiter Coen Highsmiths Einfahrt.
Ich frage mich, ob ich ihn zur Vernunft bringen könnte.
Vielleicht könnte ich sogar seine Kooperation kaufen, denn mit dem Geld aus den Lebensversicherungen meiner Eltern bin ich so ausgestattet, dass ich im Grunde genommen in meinem Leben keinen Tag mehr arbeiten muss, wenn ich nicht will. Ich lebe einfach, ohne viel Schnickschnack oder Luxus. Ich habe dieses Grundstück gekauft. Ich werde mein kleines Kunststudio mit einer Zufahrt bauen und immer noch über anderthalb Millionen Dollar übrig haben, um meine Lebenshaltungskosten über Jahre hinweg zu decken. Natürlich hoffe ich, mit meinem Studio auch Gewinne zu erzielen, aber ich brauche wirklich nicht viel. Ich kann auf jeden Fall etwas Geld entbehren, um dieses Arschloch zu bestechen, damit es mir meine Zufahrt erlaubt.
Ja, ich muss versuchen, mit ihm zu reden.
Ich fahre an meiner Einfahrt vorbei und biege stattdessen in seine ein. Obwohl unsere Grundstücke aneinandergrenzen, stößt die Rückseite seines Grundstücks aufgrund der Tatsache, dass er um eine Kurve wohnt, an die Seite meines Grundstücks. Ich habe seinem Blockhaus nie wirklich Aufmerksamkeit geschenkt, da es tief in dem Waldgebiet liegt.
Als ich auf das Haus zufahre, bemerke ich einen großen silbernen Geländewagen, der unter einem Carport steht, was wohl bedeutet, dass er zu Hause ist. Mein Herzschlag beschleunigt sich, denn ich mag keine Konfrontationen, aber ich lasse mich von meinen Träumen leiten. Ich bin in diesem Prozess schon zu weit gekommen und habe zu viel von meinem Herzen investiert, um aufzugeben und mich von Mr. Highsmith überrumpeln zu lassen.
Es ist still, als ich die Stufen zur Veranda hinaufsteige. Sein Haus ist ein echtes Blockhaus, bei dem die Stämme waagerecht gestapelt und mit Einkerbungen gesichert werden. Da diese Einkerbungen von Hand gemacht werden, sind diese Häuser nicht gerade billig.
Die Tür scheint aus dem gleichen Zedernholz zu sein wie das Haus und hat ein großes, abgeschrägtes und mattiertes Glasoval in der Mitte, das den Stil auf die frühen Neunzigerjahre datiert, also auf die Zeit, in der das Haus vermutlich gebaut wurde.
Ich drücke auf die Klingel und sehe mich um, während ich darauf warte, dass er öffnet. Als ich seine schweren Schritte höre, beschleunigt sich mein Puls, und dann sehe ich seine Gestalt durch das ovale Glas auf mich zukommen.
Die Tür schwingt auf und sein Gesicht ist zu einer harten Maske der Gleichgültigkeit erstarrt. Er sagt kein Wort, sondern sieht mich nur an.
„Ähm … ich dachte, wir könnten vielleicht reden“, sage ich und merke, wie lahm das klingt. „Über die Zufahrt.“
„Da gibt es nichts zu reden“, sagt er und beginnt, die Tür zu schließen.
„Warte!“ Ich strecke den Arm aus, um mich dagegenzustemmen. „Nur fünf Minuten.“
„Dreißig Sekunden“, entgegnet er, und ich weiß, dass die Uhr bereits tickt.
Ich stammele drauflos, ohne dass meine Worte einen Zusammenhang haben. Nach fünfzehn Sekunden merke ich, dass ich einen Fehler gemacht habe, als ich ihn auf die Rechtmäßigkeit des Nutzungsrechts hinwies, denn sein Gesichtsausdruck verrät, dass er sich einen Dreck um die Rechtmäßigkeit schert. Es ist Zeit, die Taktik zu ändern, und vielleicht bin ich nicht derjenige, der die ganze Zeit reden muss. Ich atme tief durch. „Vielleicht könntest du mir einfach sagen, warum du etwas gegen die gemeinsame Zufahrt hast.“
„Ich dachte, die Antwort wäre offensichtlich. Ich mag meine Privatsphäre, Lady. Ich will dein Studio nicht sehen und ich will keinen Verkehr dort hinten.“
„Wenn wir vielleicht einen Zaun errichten würden …“
Er knurrt. „Ich will keinen blöden Zaun.“
„Warum?“, frage ich ratlos.
Der Mann fuchtelt übertrieben dramatisch mit den Händen herum. „Ich bin ein Naturfreund. Ich ziehe Kraft und Ruhe aus Mutter Natur. Ich bin ein verdammtes modernes Schneewittchen, das mit allen Waldbewohnern kommuniziert und nicht will, dass ihr Lebensraum zerstört wird.“
Ich runzele skeptisch die Stirn. „Wirklich?“
„Nein, nicht wirklich“, sagt er mit einem Augenrollen. „Ich mag einfach meine Privatsphäre, okay? Ende der Geschichte.“
„Nun, es ist ja nicht so, dass ich alle Bäume fällen würde. Wenn du mich lassen würdest …“
„Die Zeit ist um“, verkündet er und beginnt, die Tür wieder zuzuschieben.
„Warte!“ Ich stoße mit der Schulter gegen die Holztür. „Ich verstehe nicht, warum du dich mit mir streiten musst, und ich verstehe nicht, warum du dich von Anfang an wie ein Arschloch benimmst und mich verklagst.“
„Weil ich ein Arschloch bin.“
Er kommt mir zu nah und drängt mich von seiner Tür auf die Veranda zurück. Er hört nicht auf, mich zurückzuschieben, und obwohl ich keine Angst habe, dass er mir etwas antut, weiche ich lieber zurück.
„Wie halten es deine Freunde mit dir aus?“, frage ich, zum Teil, um ihn zu ärgern, zum Teil aber auch, weil ich neugierig bin. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so konsequent unhöflich ist.
„Ich habe keine Freunde“, sagt er und bleibt stehen.
Noch ein Schritt rückwärts und ich werde von seiner Veranda fallen. „Schockierend“, murmele ich und bohre weiter. „Deine Familie muss über dein Verhalten entsetzt sein.“
„Ich habe keine Familie, die von Bedeutung ist.“ Er beugt sich vor und sieht mich an. „Ich bin kein netter Mann, also mach dir nicht die Mühe, mich durchschauen zu wollen. Das Beste, was du tun kannst, ist, von meiner Veranda zu verschwinden, bevor du bereust, hergekommen zu sein.“
Auf den ersten Blick sind das ziemlich bedrohliche Worte. Wenn man dann noch bedenkt, dass er ein Riese ist, der mich überragt, sollte ich eigentlich Angst bekommen und auf meinen Selbsterhaltungstrieb hören.
Aber ich habe keine Angst.
Wenn überhaupt, dann bin ich wütend.
Anstatt die Treppe hinunterzugehen, komme ich ihm noch näher, Kinn hoch, Brust raus, als wäre ich selbst ein harter Kerl.
Er blinzelt überrascht.
„Ich kenne Typen wie dich, Highsmith. Du glaubst, du kannst die Leute allein durch deine schiere Größe und dein fieses Wesen einschüchtern und schikanieren. Aber ich bin schon von Leuten herumgeschubst worden, die eine Million Mal bösartiger waren als du, und du machst mir nicht die geringste Angst.“
Wenn er wirklich ein böser Mensch wäre, würde er mich an dieser Stelle von der Veranda stoßen. Möglicherweise sogar schlagen.
Stattdessen ziehen sich seine Augenbrauen zusammen, als könnte er nicht begreifen, dass ich nicht mit eingezogenem Schwanz davonrenne. Er betrachtet mich lange, bevor er etwas Unverständliches murmelt. Ich vermute, es ist ein Fluch, doch er dreht sich um und geht zurück in sein Haus, wobei er die Tür hinter sich zuschlägt.
Ich balle die Fäuste und stampfe frustriert mit dem Fuß auf.
Arschloch de luxe!
Ich stürme die Treppe hinunter und marschiere zielstrebig zu meinem Auto. „Ich bin ein Naturfreund. Ein modernes Schneewittchen“, äffe ich ihn nach, nur mit einer hohen, weinerlichen Stimme, bevor ich zu meiner normalen Stimme zurückkehre. „Der Trottel muss sich nur um dreihundertsechzig Grad drehen, dann sieht er, dass er mitten im Wald ist. Was will er denn noch?“
Ich rüttele am Griff meiner Autotür, doch dann erstarre ich, als mir eine Idee kommt.
Ein modernes Schneewittchen, ja? Eine völlig lächerliche Behauptung, aber vielleicht kann ich ihn auf die Probe stellen.
Ich gleite auf den Sitz, hole mein Handy heraus und schicke eine Gruppennachricht an Ann Marie, Hayley und Erica. Ich brauche eure Hilfe. Helft mir, das Arschloch zu besiegen.
Ich drücke auf Senden. Keiner von ihnen wird eine Ahnung haben, was das bedeutet, weil ich noch niemandem von meinem neuen Drama mit diesem Kerl erzählt habe. Mein Telefon summt mit Antworten, in denen alle wissen wollen, wer das Arschloch ist, gegen das sie in die Schlacht ziehen sollen.
Grinsend antworte ich der Gruppe. Seid um acht bei mir zu Hause. Wir haben Vorbereitungen zu treffen.
Coen
Wenn man betrunken ist, trifft man dumme Entscheidungen. Das ist die einzige plausible Ausrede. Und doch bin ich in den Tiefen meines Verstandes immer noch rational genug, um zu wissen, dass Betrunkensein keine Entschuldigung ist.
Es kann keine Ausrede geben, wenn ich das durchziehe. Es ist falsch, ganz einfach.
Es spielt keine Rolle, dass ich undeutlich spreche oder dass ich nicht gerade stehen kann, ohne mit der Hand den Türrahmen zu umklammern. Es spielt keine Rolle, dass Darcy ein Kleid trägt, das so tief ausgeschnitten ist, dass man praktisch ihren Bauchnabel sehen kann, und dass ihre Brüste so entblößt sind, dass ich die rosige Färbung um ihre Brustwarzen herum deutlich erkennen kann. Es spielt auch keine Rolle, dass sie vor mir auf den Knien liegt und meine Hose öffnet, um meinen verräterischen Schwanz herauszuziehen, der erstaunlich hart ist, obwohl ich so kaputt bin.
Das Einzige, was eine Rolle spielen sollte – und ich weiß, dass ich es nicht beachten werde –, ist, dass Darcy zu meinem Teamkollegen Kyle Ralston gehört.
Oder besser gesagt, sie gehörte früher zu ihm. Sie haben sich getrennt, aber das spielt keine Rolle, wenn es um Freunde und Mannschaftskameraden geht. Man geht nicht dorthin, wo ein anderer schon einmal war.
Niemals.
Egal, wie betrunken man ist.
Das ist der Bro-Code, und es gibt keinen stärkeren Kodex als den zwischen mir und meinen Teamkameraden.
Darcys schlanke Hand legt sich um meinen Schwanz, und kein einziges verdammtes Gefühl wird durch den ganzen Wodka gedämpft, den ich heute Abend getrunken habe. Ich starre sie mit verschwommenem Blick an, und ich glaube, sie lächelt. Ein Anfall von Gewissensbissen bringt mich fast dazu, mich zurückzuziehen, aber dann ist ihr Mund auf mir und er ist heiß und feucht und sie saugt hart.
Ich rede mir ein, dass sie und Kyle sich getrennt haben, also spielt es keine Rolle. Verdammt, sie waren sowieso nur ein paar Wochen zusammen, also wie ernst kann es wirklich gewesen sein?
Das sage ich mir immer und immer wieder, selbst als meine Hüften Stoßbewegungen machen. Es fühlt sich gut an. Definitiv zu gut, um aufzuhören, aber je länger es dauert und je mehr ich mir Gedanken über die Moral hinsichtlich dieser Sache mache, desto dumpfer werden die Empfindungen.
Und als sie mir schließlich einen Orgasmus abringt, ist er glanzlos. Ich ziehe mich von ihr zurück, stopfe meinen erschöpften Schwanz zurück in die Jeans, gehe zwei Schritte und falle dann mit dem Gesicht voran auf mein Bett.
Bevor ich einschlafe, bete ich, dass ich mich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern kann.
Das Klingeln des Telefons holt mich aus meinem Traum, als hätte man mir einen Eimer Eiswasser ins Gesicht geschüttet. Ich vermute, ich werde so schnell aus dem Schlummer gerissen, weil es kein Traum war, sondern ein wiederkehrender Albtraum, der mich nur allzu oft heimsucht.
Stöhnend reibe ich mir mit einer Hand über das Gesicht und rolle mich zum Nachttisch hinüber. Ich verziehe das Gesicht, als ich sehe, dass mein Vater anruft, und überlege kurz, ob ich rangehen soll. Unsere Gespräche verlaufen nie gut, und es ist einfacher, ihn zu ignorieren.
Aber als ich aus diesem Albtraum erwache, der eher eine verschwommene, aber sehr präzise Erinnerung ist, bin ich wütend auf mich selbst und streitlustig. Ich schwinge meine Beine über die Bettkante und nehme den Anruf an. „Ja.“
„Coen, hier ist dein Vater.“
Ich weiß nicht, warum, aber ich muss an die Szene aus Das Imperium schlägt zurück denken, als Darth Vader zu Luke sagt: „Ich bin dein Vater“. Nicht wegen der Ähnlichkeit der Worte, sondern weil mein Vater dem bösen Größenwahnsinnigen ähnelt.
„Ja. Das sehe ich an der Anrufer-ID.“
„Sei nicht so respektlos“, knurrt er, und ich kann ihn fast vor mir sehen, wie er in seinem italienischen Maßanzug, mit Tausend-Dollar-Krawatte und goldenen Manschettenknöpfen an seinem Schreibtisch sitzt. „Ich habe dich besser erzogen.“
„Du hast mich überhaupt nicht erzogen“, sage ich ohne einen Funken Groll. Es interessiert mich einfach nicht mehr, wie verkorkst meine Kindheit war.
„Himmel noch mal!“ Mein Vater schlägt mit der Faust auf irgendetwas, wahrscheinlich auf seinen Schreibtisch. „Warum musst du immer so aggressiv sein? Warum kannst du die Möglichkeiten, die wir dir gegeben haben, nicht zu schätzen wissen? Du zeigst überhaupt keine Dankbarkeit.“
Ich beiße mir auf die Innenseite der Wange, denn die Wut, die in mir brodelt, möchte ihm sagen, dass ich nur ein Produkt seiner Erziehung bin. Aber wenn meine Eltern mir als Kind auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hätten, wüssten sie das. Sie müssten es nicht erst erraten.
Ich atme tief ein und langsam aus. „Was willst du?“, frage ich.
Einen Moment ist es still, und ich bin sicher, dass mein Vater verwirrt ist, dass ich nicht mit ätzenden Worten auf ihn losgehe, um ihn zu verletzen. Er hüstelt, und ich stelle mir vor, wie er an seiner Krawatte zupft. „Ich habe einen Anwalt gefunden, der dir helfen kann, die Anklage in New York loszuwerden. Ein alter Studienkollege von mir, der den Richter dort gut kennt.“
„Ich brauche deine Hilfe nicht.“
„Es ist mir scheißegal, ob du sie brauchst oder nicht. Du wirst dieses Angebot annehmen, weil du keine Verurteilung gebrauchen kannst. Es wäre für mich und deine Mutter irreparabel peinlich, also werde ich diese Scheiße in Ordnung bringen.“
Wenn ich mich mit meinem Vater streite – meine Mutter hat keine Lust, sich mit mir auseinanderzusetzen –, kann ich die meisten seiner lächerlichen Anschuldigungen weglachen. Das liegt daran, dass ich trotz ihrer Unfähigkeit, eine liebevolle Beziehung zu ihrem einzigen Sohn zu haben, Liebe, Akzeptanz, Freundschaft und Kameradschaft beim Eishockey gefunden habe. Seit ich sechs Jahre alt war, stand ich auf Schlittschuhen und bekam eine andere Art von Familie.
Ich wurde von Kindermädchen aufgezogen, die sich genauso wenig um mich gekümmert haben wie meine Eltern, aber wenigstens brachten sie mich pünktlich zum Training. Als ich vierzehn war, ging ich auf ein Eishockey-Internat und hasste die Sommer, in denen ich nach Hause musste.
Als ich für immer von zu Hause wegging, führte ich ein glückliches und erfülltes Leben. Meine Moral und meine Persönlichkeit wurden zum Glück von Mannschaftskameraden, Trainern und Gastfamilien geformt. Das waren die Bindungen, die ich über alle Maßen geschätzt habe.
Der einzige Beweis dafür, dass ein Teil meines Vaters in mir wohnt, ist, dass ich seit dem Unglück offenbar die Arschloch-DNA meines Vaters abrufe und mich mehr wie mein Vater verhalte als wie ich selbst.
Ich sollte auflegen und ihm keine Erleichterung gönnen. Ich bin sicher, er und meine Mutter haben Angst, dass ich wegen der Verhaftung in New York wieder in die Schlagzeilen gerate. Aber ehrlich gesagt bin ich des Kämpfens müde. Die Titans habe ich hinter mir gelassen und meine Eltern werde ich auch hinter mir lassen. Ich habe nicht mehr die nötige Geduld für diesen Stress.
„Ich habe mich schon selbst darum gekümmert“, sage ich meinem Vater. „Ich habe einen Anwalt beauftragt, und die Anklage wurde fallen gelassen.“
„Oh“, sagt mein Vater erstaunt. „Nun … das ist sehr … erwachsen von dir. Das hätte ich nicht erwartet.“
„Natürlich nicht“, unterbreche ich ihn. Er weiß nicht, wie man ein echtes Kompliment macht oder Stolz zeigt, was ironisch ist, weil er es früher geliebt hat, jedem, der zuhörte, von mir zu erzählen, als ich ein heißer Eishockeystar war. Seit ich suspendiert wurde, ist er schwer enttäuscht. Und das ist direkt aus seinem Mund gekommen.
„Hör mal“, sagt er steif, „ich habe einen Termin, zu dem ich muss, aber deine Mutter und ich werden nächsten Monat an einer Spendenaktion in Pittsburgh teilnehmen. Vielleicht können wir uns zum Abendessen treffen.“
„Ich bin nicht in Pittsburgh.“
„Wo bist du dann?“, fragt er.
„Nicht in Pittsburgh. War sonst noch was?“
„Ich denke nicht. Solange die Anklage fallen gelassen wurde, ist das alles, was mich interessiert.“
Das war ein gezielter Schlag und ich lasse ihn an mir abprallen. „Ja, ich weiß“, antworte ich.
Dann lege ich auf.
Ich stehe auf, strecke meinen Rücken und verziehe das Gesicht wegen des leisen Knackens in meiner Wirbelsäule. Die Matratze in diesem Bett ist scheiße. Ich habe eine neue bestellt, aber bis sie eintrifft, werde ich weiterknirschen und -knacken.
Ich ziehe ein T-Shirt und Shorts an und gehe in die Küche, um Kaffee zu kochen. Es ist ein gutes Gefühl, keinen festen Tagesablauf zu haben. Keine Verpflichtungen oder Orte, an denen ich zu einer bestimmten Zeit sein muss. Mein Plan für heute ist, alle Sträucher vor dem Haus auszugraben, denn die Hälfte von ihnen ist abgestorben. Ich weiß nicht, was ich an ihre Stelle setzen werde. Vielleicht nichts. Aber ich mag die körperliche Anstrengung.
Dann gehe ich später auf den Wegen joggen, und ich bin gespannt, ob ich die Wildkatze von nebenan wieder treffe.
Ein Teil von mir hofft darauf.
Ich habe es genossen, als sie gestern vor meiner Tür auftauchte und versuchte, einen Weg zu finden, meinen Einspruch zu umgehen. Zuerst war sie furchtbar niedlich, aber dann wurde sie feurig und ließ sich nicht einschüchtern. Ich versuchte mein Bestes, sie zu verscheuchen, aber sie plusterte sich nur auf und starrte mich an. Es war beeindruckend und ehrlich gesagt die größte Abwechslung, die ich seit meinem Umzug hierher erlebt habe.
Zugegeben, sie hat mich neugierig gemacht. Natürlich auch sauer, aber sie ist irgendwie heiß.
Auf eine merkwürdige Art.
Ich gehe zur Kaffeemaschine und werfe einen Blick durch das Küchenfenster, bevor ich die Kanne herausziehe, um sie mit Wasser zu füllen. Ich muss zweimal hinschauen, als ich meinen Garten sehe.
Ich lasse die Kanne stehen und gehe zur Schiebetür, die auf die Terrasse führt, weil ich sicher bin, dass ich durch das Fenster nicht alles richtig erkannt haben muss. Ich werde eines Besseren belehrt.
Auf meiner Terrasse liegen Hunderte von Erdnüssen mit Schale verstreut. Und in der ganzen Gegend wimmelt es von Nagetieren. Eichhörnchen und Streifenhörnchen laufen fröhlich herum, stopfen sich die Nüsse ins Maul und rennen davon, nur um von weiteren Tieren abgelöst zu werden. Um das Geländer herum stehen mehrere Schalen mit Vogelfutter, und alle möglichen geflügelten Kreaturen landen zum Fressen. Eine Menge Körner sind auf die Terrasse gefallen und überall liegt Vogelkacke.
Und verdammt … ein Waschbärenpärchen sitzt am Fuß der Treppe und frisst etwas aus einer Plastikschale, das aussieht wie Hundefutter.
Weiter hinten im Garten stehen wahrscheinlich fünfzehn Rehe mit zu Boden gebeugten Köpfen, und als ich genauer hinsehe, sieht es so aus, als hätten sie sich um Salzblöcke oder Haufen von irgendeinem Futter versammelt.
Und dahinter, vielleicht fünf Meter vor der Baumgrenze, hängen Dutzende von bunt bemalten Vogelfutterhäuschen an den Ästen. Und wenn ich Bunt sage, meine ich Neonfarben. Vögel fliegen rein und raus und kämpfen um Sitzstangen, und einige sitzen am Boden und picken nach heruntergefallenen Körnern.
Mein Garten sieht aus wie ein verdammter Zoo.
„Jesus“, brumme ich und schiebe meine Füße in die Stiefel, die in der Nähe stehen. Ich reiße die Tür auf, in der Erwartung, dass der Lärm alle Viecher auf der Terrasse verscheucht. Doch er veranlasst lediglich die Eichhörnchen und Streifenhörnchen, ein paar Meter von mir weg zu huschen. Die Vögel fliegen in die Luft, aber sie landen genauso schnell wieder.
Ich beobachte die Waschbären am Fuß der Treppe. Sie erschrecken mich ein wenig, aber zum Glück sind sie vernünftig genug, um unter die Holzterrasse zu flüchten, als ich die Stufen hinuntergehe.
Die Rehe heben ihre Köpfe, als ich in den Garten trete, und beobachten mich mit zuckenden Schwänzen. Als ich näher komme, flüchten sie in den Wald.
Ich nähere mich dem ersten weißen Block und beuge mich vor, um ihn zu untersuchen. Es ist eindeutig Salz, und ich kann sehen, dass es auf einem Spiralpfahl befestigt und in den Boden gerammt worden ist. Es gibt mehrere Haufen mit irgendeinem Futter, das wie eine Mischung aus Mais und Sonnenblumenkernen aussieht.
„Verdammte Scheiße.“ Ich schraube den ersten Pfahl ab. Es dauert eine gute Minute, bis ich ihn ganz herausgezogen habe, und ich untersuche ihn sorgfältig. Ich bezweifele irgendwie, dass Salz auf Pfählen hergestellt wird, die man im Boden befestigt. Die meisten, die ich gesehen habe, sind auf erhöhten Pfählen. Ich bezweifele nicht, dass diese hier selbst gebaut sind.
Ich werfe einen Blick auf die leuchtenden Neon-Vogelfutterhäuschen. Ich habe auch keinen Zweifel, dass diese kürzlich von einer bestimmten Künstlerin bemalt wurden, die in der Gegend lebt.
Als ich mich wieder meiner Terrasse zuwende, sehe ich, dass die Waschbären wieder an der Schüssel sitzen und dass meine Terrasse immer noch von Nagetieren und Vögeln bevölkert ist. Mein Gott, es wird ewig dauern, bis ich diesen Mist aufgeräumt habe.
Ich halte inne.
Scheiß drauf. Ich werde das nicht aufräumen.
Ich lasse den Salzleckstein auf den Boden fallen und gehe in den Wald, der unsere Grundstücke voneinander trennt, durch die Bäume, die mit neonfarbenen Vogelfutterhäuschen geschmückt sind, deren Körner auf dem Boden verstreut sind, bis ich schließlich an der Seite ihres Gartens herauskomme. Ihre Hütte liegt fünfzig Meter entfernt.
Tilden Marshall wird es noch bereuen, sich mit mir angelegt zu haben.
Ich schreite wütend durch den Garten, der noch vom Morgentau nass ist; die Luft ist schwer von Feuchtigkeit. Heute wird es heiß werden, und ich glaube, dass es ihr einiges abverlangen wird, ihr Werk aufzuräumen.
Ich erklimme die Veranda zwei Stufen auf einmal nehmend, ignoriere die Klingel und klopfe an ihre Tür.
Wenn die Frau schlau ist, wird sie sich hinten verstecken, bis ich weg bin. Stattdessen schwingt die Tür auf und sie steht da, mit einem selbstgefälligen Lächeln.
„Guten Morgen“, sagt sie strahlend.
Sie muss letzte Nacht furchtbar lange auf gewesen sein, um mein Grundstück zu präparieren, aber sie sieht frisch und gut aus. Sie trägt Jeansshorts, die am Saum ausgefranst sind, aber nicht sehr hoch an den Beinen sitzen, ein senffarbenes T-Shirt, das mit getrockneter Farbe beschmiert ist, und ein rotes Tuch, das sie in einem altmodischen Dreieck auf dem Kopf hat. Ihr lockiges blondes Haar fällt ihr in Kaskaden über den Rücken.
Wie bisher immer ist ihr Gesicht ungeschminkt, was die Sommersprossen über ihrer Nase unglaublich ablenkend macht.
„Du hast ungefähr fünf Minuten Zeit, deinen Arsch in meinen Garten zu bewegen und deinen Scheiß wegzuräumen.“
Sie legt den Kopf schief und lächelt verwundert. „Sorry, aber warum sollte ich das tun?“
„Stell dich nicht dumm, Tilden.“ Ich betone ihren Namen, damit klar ist, dass wir keine Freunde sind. „Du weißt verdammt gut, dass du meinen Garten in einen Zoo verwandelt hast.“
Sie runzelt die Stirn, die Unterlippe steht ein wenig hervor. „Ich verstehe nicht“, sagt sie sanft. „Du hast gesagt, dass du ein Naturfreund bist. Wie hast du dich noch mal genannt? Ein modernes Schneewittchen? Es würde mich nicht wundern, wenn jeden Moment ein blauer Vogel auf deiner Schulter landen würde.“
„Fuck“, sage ich, drehe mich frustriert von ihr weg und gleich wieder um. Ich trete näher und zeige mit einem Finger auf sie, was wahrscheinlich der Gipfel der Unhöflichkeit ist, aber das ist mir egal. „Du bist die nervigste, wenn nicht sogar die verrückteste Frau, die ich je getroffen habe. Du hast keinen Respekt vor anderen Menschen, bist egozentrisch und zickig. Wahrscheinlich bist du nicht einmal eine gute Künstlerin, also ist es Geldverschwendung, das Studio zu bauen. Du trägst Oma-Schlüpfer, und das Kopftuch sieht bescheuert aus. Du denkst, die Welt schuldet dir was, und es ist dir egal …“
Tilden legt eine Hand auf meine Brust, und ich stütze mich ab, in der Erwartung, dass sie mich rückwärts von der Veranda stoßen will. Stattdessen krallen sich ihre Finger in mein T-Shirt und sie zerrt mich vorwärts. Normalerweise könnte ein kleines Ding wie sie keinen Berg wie mich bewegen, aber ich habe mich nach vorn gebeugt, während ich sie beschimpft und versucht habe, sie einzuschüchtern. Dabei bin ich aus dem Gleichgewicht geraten.
Bevor ich meinen Schwung stoppen kann, ist sie auf den Zehenspitzen und presst ihren Mund mit einem überraschenden Kuss auf meinen. In meinem Kopf dreht sich alles.
Ich stoße mich grob ab und schlage ihre Hände von meinem Shirt. „Was zum Teufel soll das?“
Sie zuckt mit den Schultern und steckt ihre Hände lässig in ihre Taschen. „Ich dachte, das wäre der beste Weg, um dich zum Schweigen zu bringen und deine lächerliche Tirade zu beenden.“
Gott, sie ist seltsam, und warum kribbeln meine Lippen?
Meine Reflexe sind blitzschnell, das kann jeder in der Eishockey-Profiliga bestätigen, und meine Hände schießen vor, um ihre Wangen zu umfassen. Mit den Daumen unter ihrem Kinn ziehe ich sie zu mir heran und bin zufrieden, als ich sehe, wie ihre Augen vor Schreck und Erregung aufflackern. Ich ziehe sie hoch, sodass sich unsere Nasen fast berühren und unsere Lippen ebenfalls.
Ihr Atem streicht über meinen Mund und dann atmet sie wieder ein.
„Tilden?“, flüstere ich und wundere mich, dass ihre Augen auf Halbmast gehen. Mein Gott. Macht sie das an? Mein Schwanz zuckt. Irgendetwas passiert hier gerade.
„Ja?“, wispert sie, als wäre sie in einem Bann gefangen.
Ich beuge mich vor, berühre ihre Lippen mit nicht mehr Kraft, als würde ein Schmetterling auf ihrem üppigen Mund landen. Ein stotternder Atem entweicht ihr, und das ist verdammt sexy. Es fällt mir schwer, meinen Mund nicht auf den ihren zu pressen, aber ich bleibe standhaft.
„Du hast den ganzen Tag Zeit, meinen Garten aufzuräumen. Andernfalls rufe ich die Polizei.“
Die Erkenntnis, dass ich sie nicht küsse, sondern bedrohe, setzt ein, und ihre Hände sind wieder an meiner Brust, diesmal drücken sie fest dagegen.
Ich bin vorbereitet und rühre mich nicht von der Stelle.
Jedenfalls nicht für einige Sekunden. Ich halte sie fest, unsere Lippen noch immer leicht aneinander, bevor ich meine Hände fallen lasse. Ich trete zurück, lächele und deute einen Salut an, weil ich die Kontrolle über dieses Spiel zurückerobert habe.
„Bis heute Abend“, erinnere ich sie. „Aber wenn du nicht willst, werde ich zusehen, wie sie dich verhaften. Ich wette, Handschellen stehen dir gut.“
Ja, der letzte Satz mag eine Anspielung gewesen sein, aber ich meine es auch todernst. Sie sollte besser aufhören, mich zu verarschen, denn obwohl sie mich schon jetzt für ein Arschloch hält, hat sie meine wahre Seite noch nicht gesehen.
Und doch merke ich beim Weggehen, dass mir die Sache nicht gefällt. Nicht die Drohung, die Polizei zu rufen; dazu stehe ich, denn ich will, dass mein Garten aufgeräumt wird. Und ich habe etwas über Tilden Marshall gelernt. Sie ist verschlagen und stur und wird es nicht freiwillig tun. Ich brauche die Polizei als Druckmittel, um sie zum Einlenken zu bewegen.
Aber dieser Kuss ist mir nicht geheuer.
Es braucht viel, um mich zu überrumpeln. Es braucht noch mehr, um mich zu überraschen. Aber die Tatsache, dass sie mich gepackt hat …
Sie hat mich zuerst geküsst.
Sie hat einen verdammt mutigen Schritt gemacht, und das macht mich neugierig. Neugierig auf die Frau, die so viel Selbstvertrauen hat. Dass mein Körper auf sie reagiert hat, ist rätselhaft, denn sie ist normalerweise nicht mein Typ. Supermodel-ähnliche Frauen in knappen Klamotten sind eher mein Ding. Wenn man dann noch bedenkt, dass sie mich zu Tode nervt, macht sie mich noch neugieriger. Was mich am meisten stört, ist, dass es mir schwergefallen ist, ihren Kuss nicht zu erwidern. Dass ich tatsächlich damit rang, mein Druckmittel und meine Drohungen aufzugeben, nur um zu sehen, wie sie wirklich schmeckt.
Das macht mir Angst. Es ist das erste Mal, dass ich einen Blick auf den alten Coen Highsmith erhaschen kann. Der Mann, der vor dem Unglück existierte. Er ist derjenige, der über eine Frau gelacht hätte, die seinen Garten in ein Naturschutzgebiet verwandelt und neonfarbene Vogelfutterhäuschen in seine Bäume gehängt hat. Der Mann, der ich einmal war, hätte sie verdammt noch mal geküsst und wäre auf der Stelle mit ihr ins Bett gegangen, wenn sie gewillt gewesen wäre.
Als ich zurück in Richtung der Baumgruppe gehe, die mein Grundstück von ihrem trennt, beunruhigt mich vor allem die Tatsache, dass ich immer noch damit kämpfe, mich nicht umzudrehen und zu ihr zurückzugehen.