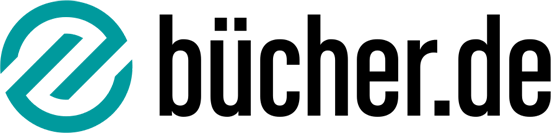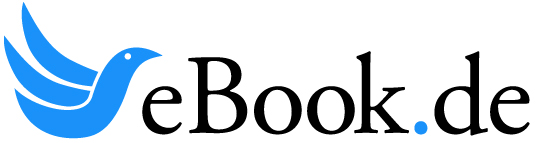paperback & ebook
Print: 978-3-93828-164-2
ebook: 978-3-86495-007-0
Print: 14,90 €[D]
ebook: 6,99 €[D]
Blutseelen: Amalia
Sarah Schwartz
Inhaltsangabe
Als Amalia auf den verführerischen Aurelius trifft, ahnt sie, dass ihre Zusammenkunft mehr als ein Zufall ist. In erotischen Träumen hat sie Aurelius bereits gesehen und seine Gegenwart löst in ihr rätselhafte Erinnerungen aus. Amalia fühlt sich, als sei sie für Aurelius bestimmt, gibt sich ihm vertrauensvoll hin und lässt sich von ihm in die Tiefen ihrer Lust entführen.
Doch was als aufregende Zeit mit einem geheimnisvollen Mann beginnt, verwandelt sich in einen Albtraum, als Amalia erkennen muss, dass Aurelius und seine Freunde Vampire sind, und sie selbst der Schlüssel zu einem düsteren Geheimnis ist, das vor Jahrtausenden im Nebel der Geschichte verloren ging ...
Band 1 der Blutseelen-Trilogie.
Über die Autorin
Sarah Schwartz (Jahrgang 1978) wuchs in Frankfurt/M. auf, wo sie nach dem Abitur den Magisterstudiengang Germanistik mit den Nebenfächern Psychologie und Kunstgeschichte absolvierte. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums begann sie zu schreiben und arbeitete nebenher vom Kommissionieren bis zum Dozieren....
mehr über die Autorin erfahren
Weitere Teile der Blutseelen Serie


Leseprobe
Szene 1
Straßburg, April
Das Geläut des Münsters erklang in der Ferne des Nachmittags und ergoss sich in die engen Straßen und Gassen. Ein Spiel aus Tönen, wie man es nirgendwo sonst in Europa hören konnte. Ein Meisterwerk, das selbst das Herz des verirrtesten Sünders anrührte, doch Aurelius warf nicht einmal einen Blick in die Richtung des winzigen, geklappten Fensters des Fachwerkhauses. Gereizt zog der Vampir eine weitere Schublade des alten Schreibtischs aus Nussbaumholz auf. Seine Gedanken waren ganz in seine Aufgabe vertieft.
Wo hatte dieser Bastard seine Unterlagen versteckt?
Der Klan hatte schon lange eine Vermutung, was die Vergangenheit von Pierre...
vollständige Leseprobe
...de la Rougé betraf, doch bisher gab es keinen Beweis. Nun war der alte Mann tot. Herzversagen. Sein Körper war abgeholt, sein Geruch lag noch immer wie eine schlechte Aura aus Tod und Verwesung über allem, was Aurelius berührte.
Seine empfindlichen Sinne wurden beleidigt von der Profanität des Todes, von dem erstickenden, süßlichen Parfüm, das zu viele Erinnerungen weckte, in einem Wesen wie ihm, das im Dreißigjährigen Krieg gelebt hatte und gestorben war. Aber damit wollte er sich jetzt nicht befassen. Er hatte einen Auftrag. Die Zeit war knapp. Schon bald würden die neuen Besitzer der winzigen Wohnung auftauchen und das Haus in Beschlag nehmen. In wenigen Minuten konnte der Laster kommen, der die alten Möbel und vergilbten Bilder samt ihrer Staubschicht abholen würde, um Raum für Neues zu schaffen.
Zwischen Tradition und europäischer Zukunft auf der Grande Île zu leben, war der Traum vieler Straßburger, und sie waren bereit, ein Vermögen dafür auszugeben.
Aurelius stieß die Schublade heftig zu. Er schloss die Augen. Langsam atmete er ein und aus. Obwohl er nicht wie ein Mensch atmen musste, beruhigte ihn dieser vertraute Prozess. Seine Gedanken sammelten sich, wurden zu einem Mantra, das er dachte, wie er es oft in schwierigen Situationen gedacht hatte.
Nein. Ich versage nicht. Ich habe niemals versagt.
Als Gracia ihm erzählt hatte, was Rene plante, war ihm bewusst geworden, was er alles zu verlieren hatte. Die Existenz seines Klans stand auf dem Spiel. Er war geschickt worden, weil er der Beste war. Wenn er die Dokumente nicht fand, fand sie niemand.
Mit geschlossenen Augen lauschte er, drängte das Geläut der großen und kleinen Glocken des Münsters beiseite. Unten im Haus kochte eine Frau ein spätes Mittagessen. Sie summte leise, während Holz gegen Metall schlug – sie rührte in einem Topf. Aurelius roch den scharfen Duft von Zwiebelsuppe, der über dem Geruch nach Tod und Verwesung lag. Aber da war noch mehr. Eine ganze Welt aus Gerüchen, die darauf wartete, von ihm durchdrungen zu werden. Auch Papier hatte einen Geruch. Es roch scharf und säuerlich. In diesem Schreibtisch gab es ganz verschiedene Papiersorten, die auf unterschiedliche Art und Weise behandelt worden waren. Jede Herstellung hinterließ einen anderen Geruch, einer Prägung gleich, und hinter jeder Herstellungsart erkannte er das Material: Zellstoff, Holzstoff, Altpapier, Fichte, Tanne, Kiefer.
„Kiefer ...“, flüsterte er, und riss mit einer fließenden Bewegung die oberste Schublade auf. Sie war leer. Aber der Geruch war unverwechselbar. Schwach drang er unter dem Nussbaumholz hervor, verheißungsvoll.
Mit dem Finger fuhr er über den Boden der Schublade. Mühelos drang sein messerscharfer Daumennagel in das Holz ein und ein haarfeiner Riss entstand. Ihm stand nicht der Sinn danach, lange nach einem geheimen Mechanismus zu suchen. Vielleicht gab es gar keinen. Das Holz konnte als doppelter Boden aufeinander geleimt worden sein, um das Versteck sicher zu machen. Er ignorierte die winzigen Holzsplitter, die sich in seine Hand gruben. Seine Haut erkannte sie innerhalb von Sekundenbruchteilen als Fremdkörper und stieß sie ohne sein Zutun ab.
Triumphierend riss er den doppelten Boden endgültig auseinander. Etwas weiß Schimmerndes lag vor ihm. Fieberhafte Erregung pochte in seinen Adern. Er riss die Papiere an sich, die in einer an zwei Seiten offenen Plastikfolie auf ihre Entdeckung gewartet hatten. Mit einer einzigen Bewegung streifte er die Folie ab und ließ sie achtlos auf den braunen Teppich fallen.
Hastig blätterte er die Dokumente durch, erfasste Seite um Seite den kompletten Inhalt. Namen und Daten bestätigten ihm, das Gewünschte gefunden zu haben. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Als er die Papiere gelesen hatte, steckte er sie zurück in die Folie, trat an das geklappte Fenster und sah zur Ill hinunter, deren Arme die Insel der Altstadt schützend umflossen.
Er hatte das Geheimnis entdeckt.
Erneut atmete er tief ein und aus. Die kühle Frühjahrsluft vertrieb den erstickenden Todesgeruch aus seinen Lungen.
Er griff zu dem Handy an seiner Seite und berührte die Oberfläche. Es dauerte nicht lange, bis er gewählt hatte, und noch kürzer, bis Gracia abhob.
„Pierre hatte einen Sohn“, sagte er mit fester Stimme, als er Gracias Gegenwart am anderen Ende der Leitung fühlte.
Gracia zögerte. „Dann hat er vielleicht weitere Nachfahren. Du weißt, was das heißt?“
„Es könnte ein Seelenblut darunter sein. Eine Wissende.“
„Komm mit den Unterlagen nach Frankfurt zurück. Wir haben wenig Zeit.“
„Ich komme.“ Aurelius legte auf. Er öffnete das Fenster ganz, wartete, bis niemand in seine Richtung sah, und schwang sich aus dem Rahmen hinunter auf die drei Meter tiefere Straße. Die Bewegung war so schnell, dass ein Mensch ihr nicht folgen konnte. Auf der Straße zog er sich mit einer Hand den schwarzen Mantel glatt und strich sich durch die langen, goldbraunen Haare. Zielstrebig ging er in Richtung Münster. Obwohl er es eilig hatte, wollte er dem imposanten Bau mit seinen eindrucksvollen Glasfenstern einen Besuch abstatten. Er wusste selbst nicht genau, warum er diesem Drang nicht widerstehen konnte. Vielleicht wollte er ein Grabmal Gottes bewundern, und in Erinnerungen eintauchen. Noch vor zwei Jahrhunderten hatte er in Frankreich gelebt, auf dem Anwesen seiner Vorfahren in der Nähe von Montbéliard.
„Du bist ein sentimentaler Schwachkopf“, schimpfte er leise mit sich. Es gab Wichtigeres zu tun, als ein altes Bauwerk zu bewundern. Die Gegenwart rief nach ihm. Seine Hände umschlossen die Papiere.
Seine Stimme war so leise wie der Windhauch zwischen den Häusern. „Wenn es ein Seelenblut gibt, werde ich es finden und es zu ihr bringen. Sie wird das Geheimnis aus dem Nebel der Zeiten heben.“
Aurelius wusste, dass das nicht genügen würde. Er würde das tun müssen, was er hasste, und was er seit Jahrzehnten vermied. Sobald sein Klan die benötigten Informationen hatte, würde er töten müssen. Das Geheimnis war nur dann sicher, wenn seine Quelle ausgelöscht wurde. Vielleicht war das der wahre Grund, warum er wie ein Sünder in die Kirche lief, auch wenn er seinen Glauben schon vor Jahrhunderten verloren hatte. Er hoffte auf eine Absolution, die ihm niemand erteilen konnte.
Szene 2
„Sieh mich an“, sagte er leise. Seine rechte Hand lag weiter auf ihrer Brust. Die linke drückte sich plötzlich auf ihre Hose. Durch den dünnen Lackstoff fühlte sie die Berührung überdeutlich. Seine Finger massierten ihren Schamhügel. Ihr Inneres zog sich lustvoll zusammen. Sie riss die Augen auf.
Was tat sie hier eigentlich. Die Stimme der Vernunft wollte sich in den Vordergrund drängen, doch sie unterdrückte sie. Sie wollte nicht nachdenken, sondern nur den Augenblick genießen.
Sein Blick hielt ihren. Amalia konnte weder fortsehen noch blinzeln. Als ob er einen Bann auf sie ausüben würde. In seinen Pupillen lagen die Bilder aus ihren Träumen. Frankreich. Das Anwesen. Schneeflocken und Wölfe.
Wölfe?
Sie verstand ihre Gedanken nicht. Erneut beschlich sie Angst und sie versteifte sich. Nach dem Tod ihres Vaters hatte sich ihre Mutter eine Zeit lang in Traumwelten verirrt. Sie war dissoziativ gewesen, hatte daran geglaubt, dass der Geist ihres verstorbenen Mannes mit ihr sprach und ihr Vorwürfe machte. Verlor sie den Verstand? Aber warum sollte sie den Verstand verlieren, es gab nichts, was sie bedrohte.
„Entspann dich“, sein Flüstern vertrieb alle Zweifel. Seine Augen gaben seinem Gesicht einen warmen Ausdruck. Sie fühlte Geborgenheit, die sie umgab. Das Bild eines dunklen Engels stieg vor ihr auf. Sie konnte sich Aurelius gut mit einem Flammenschwert vorstellen. Sein athletischer Körper war der eines Kämpfers.
Sie stöhnte auf, als seine Hand Knopf und Reißverschluss öffnete und in ihre Hose glitt. Ihre Klitoris pulsierte unter seinen Fingern. Zielgenau traf er sie und drückte zärtlich zu. Als sie glaubte, es nicht mehr aushalten zu können, zog er seine Hand zurück. Seine langen Haare kitzelten ihren Hals. Unentwegt blickte sie in diese dunkelbraunen Augen. Sein Blick war spöttisch und zugleich fasziniert, als würde er vor sich ein Wunder sehen. Sie hob den Kopf und kam ihm entgegen, um endlich seine Lippen schmecken zu können. Das Gefühl, sich ein Leben lang nach diesem einen, nach seinem Kuss, gesehnt zu haben, war überwältigend.
Sein Gesicht näherte sich ihrem. Unbewusst schloss sie die Augen und fühlte eine Erleichterung, als habe er sie freigelassen aus seinem Bann. Warm und fest lagen seine Lippen auf ihrem Kinn. Er küsste sie zärtlich, während seine Hände noch immer über ihren Körper glitten, als könne er nicht genug von ihr bekommen. Seine Lippen umkreisten ihre, gaben ihr kleine Küsse neben den geöffneten Mund. Sie wagte nicht, sich einfach zu nehmen, was sie wollte. Erregt wartete sie auf ihn. Auf seine Zunge, die endlich ihren Weg zu ihrer Zunge fand. Er nahm ihren Kopf in beide Hände und beugte sich vor. Sein Duft ließ sie schwindeln. Sie tauchten ineinander. Seine Zungenspitze berührte ihre. Augenblicklich spürte sie, wie etwas mit ihr geschah. Sie keuchte vor Schmerz, als sich neue Bilder aufdrängten: eine Frau, weißblond, mit den kältesten blauen Augen, die sie je gesehen hatte. Sie hatte lange Zähne, das Gebiss eines Raubtiers. Blut bedeckte das makellose, weiße Gesicht.
„Niemals“, flüsterte eine kalte Stimme in ihrer Erinnerung. „Höre auf meine Worte: Niemals sollst du dich erinnern! Eher wirst du sterben!“
Amalia schreckte zurück. Sie fühlte innerlich, dass sie diese Frau kannte. Dass die Fremde Teil von einem vorherigen Leben war. Es stimmte alles. Sie war in Frankreich gewesen, als Sklavin von Aurelius oder zumindest einem seiner Vorfahren. Sie kannte ihre Geschichte und spürte zugleich, dass sie gar nichts wusste. Sie war eine Nussschale, die auf dem Meer in einem Sturm hin- und hergerissen wurde. Ihr Magen brannte, ihr Herz schlug hart und schmerzhaft in ihrer Brust. Ihr Kopf schien in Flammen zu stehen.
„Nein!“, keuchte sie auf. Sie stieß den verwirrt dreinblickenden Aurelius zurück, sprang auf und lief blindlings davon. Ihre Angst war ein schwarzer Mantel, der sie kalt und vernichtend umgab. Sie rannte, als sei der Teufel hinter ihr her.
„Amalia!“
Er rief nach ihr. Doch sie hetzte vorwärts, schlug sich zwischen zwei Büschen hindurch. Zweige peitschten in ihr Gesicht und hinterließen brennende Striemen. Das Gefühl in ihrer Brust drohte, sie zu zerreißen.
Nein, das war nicht möglich. Es gab keine vorherigen Leben!
Ihr Verstand kämpfte verzweifelt, aber das Gefühl war übermächtig. Panik überfiel sie. Sie musste weg. Weg von Aurelius. Weg von seinen Freunden. Sie waren Teufel! Bluttrinker! Dämonenbrut, allesamt!
Sie spürte, wie ihr lose geschnürtes Korsett immer tiefer rutschte, doch in ihrem Zustand war ihr das gleich, sie wollte nur fort. Auch ihre Hose verhakte sich an einem Strauch und riss. Sie rannte weiter. Fort von ihm. So schnell sie ihre Beine trugen. Weiter und weiter, ohne innezuhalten. Bis sich die Welt plötzlich überschlug. Erst war etwas an ihrem Fuß – eine Hand, die sie packte, oder eher eine Wurzel – dann stürzte sie einen Abhang hinab. Himmel und Gras wechselten einander. Sie überschlug sich mehrmals, ehe sie mit einem erstickten Schrei auf dem Boden eines Grabens landete. Sie hörte das Plätschern von Wasser. Der Himmel über ihr verdunkelte sich. Sie spürte, wie ihr Bewusstsein schwand. Stöhnend griff sie sich an den Kopf. Dort war etwas Feuchtes. Sie versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, doch die Ohnmacht riss sie unaufhaltsam mit sich.
Der Graben samt dem Park war auf einmal verschwunden. Sie fand sich in einem Wald wieder. Mitten im Schnee. Kälte umgab sie. Ihre Beine schmerzten und sie fror erbärmlich. Fahles Licht fiel zwischen den Baumkronen hindurch. Irgendwo jaulte ein Wolf.
Es war dieses Jaulen, das sie zum Aufstehen brachte. Hustend kämpfte sie sich auf die Füße. Der Wolf war ganz in ihrer Nähe und der Winter war hart. Mehrfach hatte sie in Paris Berichte über Wölfe gehört, die nicht nur Vieh rissen, sondern auch Menschen angriffen. Sie hatte gehofft, dass es nur die üblichen Klatschgeschichten der alten Frauen in ihrer Gasse waren. Übertreibungen. Doch in diesem Augenblick wollte sie sich nicht auf Vermutungen und Hoffnungen verlassen. Sie musste weiter. Seit drei Tagen war sie unterwegs und hatte kaum geschlafen. Ihr Körper war kraftlos, doch der Überlebenswille zwang sie vorwärts. Sie sah sich in dem wuchernden Waldstück um. Schneebedeckte Tannen und kahle Laubbäume umgaben sie wie stumme Wächter. Es war so still, wie es im Herzen von Paris niemals war. Selbst die Vögel schwiegen. Die einzigen Geräusche in dieser weißen Winterpracht waren ihr Atem, der dampfend aus ihr wich, und das leise Rieseln des Schnees, der sich auf Äste und Eiskrusten setzte.
Sie versuchte, nicht darüber nachzudenken, dass sie ihre Füße kaum mehr spürte. Es war nicht ihr erster Winter in der Wildnis. Aber der erste Winter ohne Hoffnung.
Erneut durchbrach das Jaulen eines Wolfes die Stille. Dieses Mal klang es näher.
„Maria, steh mir bei“, flüsterte sie in die Kälte. Der Wolf hatte sie gewittert. Sie sah sich im Gehen die umstehenden Bäume an. Dort vorne. Da stand eine Kiefer mit tief herabhängenden Ästen. Das Jaulen erklang erschreckend laut. Der Wolf hatte sie fast erreicht.
Sie lief immer schneller, hetzte wie ein gejagtes Reh auf den Baum zu.
Im Laufen sah sie den Wolf, der neben ihr zwischen Büschen und Bäumen hervortrat, lautlos und anmutig eine Pfote vor die andere setzend. Das grauschwarze Fell war gesträubt, das Maul geöffnet. Zwischen den Lefzen ragten scharfe Zähne hervor. Das Tier sah sich um, als müsse es sich orientieren.
Sie zog sich den Baum hinauf. Der Wolf entdeckte sie und sprang los. Leichtfüßig erreichte er ihren Fluchtbaum und warf sich hinauf. Sie schrie auf, als seine Zähne dicht unter ihrem Stiefel zuschnappten. Panisch floh sie höher. Erst, nachdem sie gut drei Meter hinaufgeklettert war, blickte sie zurück.
Es war der größte Wolf, den sie je gesehen hatte. In seinen Augen lagen Bosheit und Verstand. Etwas an seinem Blick erschien ihr lauernd. Der Wolf setzte sich in den Schnee und sah zu ihr herauf. Das war nicht das Verhalten, das sie von einem wilden Wolf kannte. Sie hatte erwartet, dass er aufgeregt am Baum hochspringen, oder ungeduldig auf und ab gehen würde. Außerdem war das Tier allein. So sehr sie auch Ausschau hielt, sie konnte kein Rudel entdecken. Trotzdem fühlte sie keine Erleichterung. Der Wolf unter dem Baum sah stark genug aus, sie zu zerreißen. Er wog bestimmt mehr als sie, und wenn sich seine Zähne erst in ihr Fleisch senkten, war es zu Ende. Sie spürte Tränen über ihre gefrorenen Wimpern laufen.
„Warum?“, schluchzte sie leise. Hatte Gott seine schützende Hand endgültig von ihr fortgenommen? Musste sie der Verdammnis anheimfallen? Sie hatte sich immer bemüht, ein gutes Mädchen zu sein und eine gute Frau. Dass ihr Mann früh gestorben war, war nicht ihre Schuld, und für die Taten ihrer Mutter trug sie keine Verantwortung. Die Richter des Königs sahen das anders, aber Gott kannte die Wahrheit. Warum stand er ihr nicht bei?
Sie fühlte, wie entkräftet sie war. Die Augen drohten ihr immer wieder zuzufallen, selbst wenn sie weinte. Bald würde sie hinunterstürzen und der Wolf bekam sein Festmahl.
Schneeflocken setzten sich auf sie. Ein Leichentuch. Sie war schon tot. Es gab keine Hoffnung mehr. Sie sah, wie die Sonne hinter dem Wald unterging. Eine Nacht auf dem Baum würde sie nicht lebend überstehen. Entweder sie erfror, oder sie wurde gefressen. Wieder weinte sie. Krämpfe schüttelten ihren Körper. Sie schrie um Hilfe. Schrie nach Gott, fluchte und flehte. Aber sie wusste, dass da draußen niemand war. Nur der Wolf, der sie mit seinen quecksilbernen Augen ansah, als belustigten ihn ihre Wutanfälle und ihre Tränen.
Wach bleiben ... am Leben bleiben ... wach ... bleiben ... am ...
Die Gedanken lösten sich auf in Dunkelheit.
Sie musste eingeschlafen und vom Baum gestürzt sein, denn das, was sie weckte, war ein harter Aufprall im Schnee. Sie schrie. Neben ihr sah sie den Wolf, der herumschnellte. Verzweifelt versuchte sie, aufzustehen, doch ihre Beine gehorchten ihr nicht. Der Wolf wog mindestens so viel wie ein erwachsener Mann. Sie sah die breiten Pfoten dicht vor ihrem Gesicht. Das Maul öffnete sich. Ein Geruch nach Aas und Verwesung streifte sie; eine feuchte Wärme, die auf der erfrorenen Haut schmerzte. Sie betete zu Gott, als der Wolf sich auf sie stürzte – und dieses Mal wurde sie erhört.
Der Schuss war so laut, dass sie zusammenfuhr, als habe man sie geschlagen. Der Wolf jaulte und wich zurück. Ein zweiter Schuss folgte. Dann ein dritter. Das Gewehr klang wie eines der königlichen Armee. So hatte es auch in Paris geklungen. Amalia schluckte. Waren sie ihr so weit gefolgt? War das nun das Ende? Würde man sie zurück nach Paris schleppen und sie so lange der hochnotpeinlichen Befragung unterziehen, bis sie Dinge gestand, die sie nicht getan hatte?
Sie versuchte, davonzukriechen, als ein Mann in einem langen schwarzen Mantel auf sie zu kam.
„Bitte“, keuchte sie. „Bitte, Herr, lasst mich gehen, ich bin unschuldig!“
Der Mann hob sie vom kalten Boden auf, als wöge sie nichts. Er trug sie zu seinem schnaubenden Pferd. Sie versuchte, noch etwas zu sagen, aber die Erschöpfung war zu groß. Ihr wurde schwarz vor Augen.
Erst Stunden später kam sie in einer Jagdhütte wieder zu sich. Ein Feuer brannte und sie war in zahllose Decken gehüllt. Trotzdem war ihr eiskalt. Ihr gegenüber saß der Fremde auf mehreren Wolfsfellen auf dem steinernen Boden. Sie erkannte den toten Riesenwolf, der ein Stück abseits lag.
„Wo ...“ Ihre Stimme brach, sie hatte Halsschmerzen.
Die goldgrünen Augen des riesigen Mannes blickten auf sie herab. Weder gütig, noch verurteilend. Er stand auf und brachte ihr eine Flasche, die er an ihren Mund setzte.
„Trink das und stell keine Fragen.“
Sie tat, was man ihr befahl, so, wie sie es immer tat. Die Flüssigkeit rann heiß ihre Kehle hinab. Es brannte wie Feuer. Sie hustete, spürte, wie ihr warm wurde, und ihre Halsschmerzen augenblicklich nachließen. Sie sah den Mann dankbar an.
Er war vornehm gekleidet. Vermutlich war er adelig. Die goldbraunen Haare trug er zu einem Zopf geflochten. Allein sein Hemd sah so teuer aus, dass sie einen Monat von dem Geld hätte leben können.
„Danke, Herr.“
Er schaute sie an. Musterte sie abschätzend. „Was hast du hier draußen in meinem Wald zu suchen?“
Sie senkte den Blick und schwieg. Er packte ihr Kinn und hob ihren Kopf. Sie musste in seine Augen sehen. In diese goldgrünen Augen, die nicht von dieser Welt waren.
„Ich bin ein ungeduldiger Mann und ich mag keine Lügen. Rede schnell und wahr, oder du wirst es bereuen.“
Sie schluckte. „Ich ... ich bin davongelaufen, Herr. Aus Paris. Meine Mutter hat ihren zweiten Mann mit Gift umgebracht, und da mein Mann auch in diesem Jahre verstarb, glaubt man, ich sei mit meiner Mutter verbündet und habe Schuld an seinem Ableben. Aber ... ich bin unschuldig, Herr. Mein Mann hatte eine Lungenentzündung. Gott helfe mir, ich wollte ihm nie Böses.“
Er ließ sie los. „Unschuld. Was ist das schon?“
Sie schwiegen. In ihr wurde die Angst immer größer. Sie zitterte. „Werdet ... werdet Ihr mich ausliefern, Herr?“
Sein Blick glitt erneut über sie. Er schien nachzudenken. „Was bietest du mir, wenn ich es nicht tue?“
Sie schluckte. „Ich bin fleißig und ich kann kochen. Ich arbeite gut und schnell. Wenn Ihr mich mitnehmt, kann ich Euch dienen.“
Er riss die Decken von ihrem Körper. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie nackt war. Vor Scham senkte sie den Blick. Er hatte ihr die Kleider genommen.
„Ich bin nicht an deinen Kochkünsten interessiert.“ Er hob eine ihrer schwarzen Haarsträhnen zwischen zwei Fingern in die Höhe. „Aber vielleicht hast du ja noch mehr zu bieten?“
„Ich ...“ Sie suchte nach Worten. Es hatte nie viel Geld in ihrer Familie gegeben, doch so tief war sie nie gefallen. Bis zu dieser Stunde hatte sie ihren Körper nicht verkaufen müssen. Ihr fiel keine Entgegnung ein. Atemlos sah sie in sein Engelsgesicht. Er hatte sie gerettet und er war schön. Viel schöner, als der alte Händler, mit dem ihre Mutter sie vor drei Jahren verheiratet hatte, um selbst mehr Geld zu haben.
Aber dieser Mann hatte etwas Böses an sich. Etwas an ihm war der Dunkelheit verfallen. Sie sah es an seinen Augen. So schön sie auch waren, in seinem Blick lauerten Abgründe.
„Es ist deine Entscheidung“, sagte er gönnerhaft. „Entweder gehst du aus dieser Hütte und verschwindest von meinem Grund, oder du tust uns beiden einen Gefallen und bedankst dich für deine Rettung, wie es sich gehört.“
„Wenn ... wenn ich gehe ... gebt Ihr mir dann meine Kleider wieder?“
Er schüttelte lächelnd den Kopf.
„Ihr lasst mir keine Wahl.“
„Es gibt immer eine Wahl. Wie heißt du?“
„Marie.“
Er verzog das Gesicht. „Einfallslose Eltern. Vermutlich bist du ganz furchtbar gottesgläubig?“
Sie nickte heftig.
„Vergiss Gott und erwähne seinen Namen nicht in meiner Gegenwart. Wenn ich bei dir bin, bin ich dein Herr. Du wirst mir dienen, und mir all die Dinge geben, die Gott ohnehin nicht an dir interessieren.“
Sie schwieg. Was sollte sie tun? Es schien kein Entkommen zu geben, keine Fluchtmöglichkeit. Entweder gab sie ihm nach oder sie starb. Obwohl sie nicht sterben wollte, zögerte sie. Sie hatte das Gefühl, der Teufel selbst würde vor ihr stehen, um sie zu prüfen. Aber selbst wenn es so war – sie war nur ein Mensch. Menschen waren fehlbar.
Er sah sie auffordernd an. „Worauf wartest du? Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.“ Er löste seinen Gürtel und ließ die Hose ein Stück sinken. Nackte Haut kam zum Vorschein. Sie war weiß wie Alabaster und wirkte ebenso fest. Seine Hand legte sich auf ihren Nacken. Er zog ihren Kopf in seinen Schoß.
Marie kannte das von ihrem verstorbenen Mann. Er hatte sie nicht oft gewollt, weil er fett und faul war, und jegliche Art der Anstrengung hasste. Aber hin und wieder war er zu ihr gekommen.
Sie sah ihn an, und wusste, dass sie leben wollte. Wenn das der einzige Weg war, dem Tod zu entkommen, dann würde sie ihn gehen.
Ergeben glitt sie aus ihrer sitzenden Position auf die Knie, umschloss sein kühles Glied mit ihren Lippen und begann, sich zu bewegen.