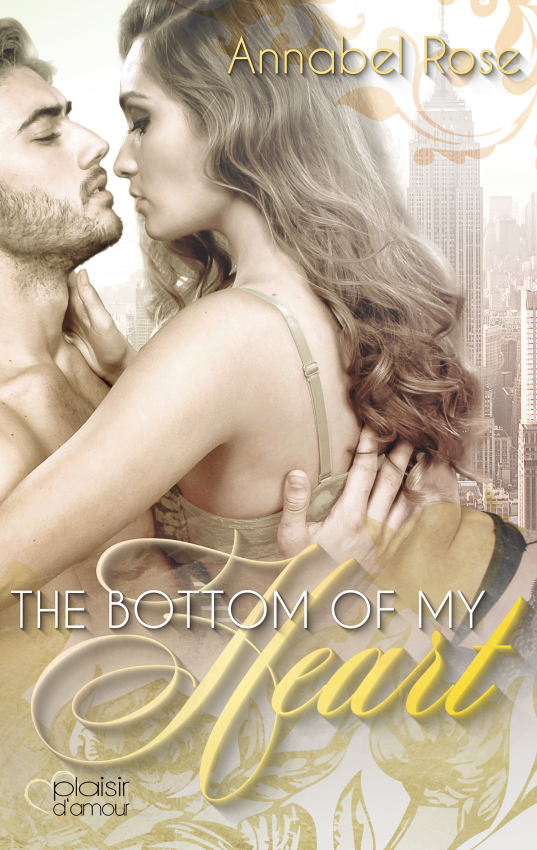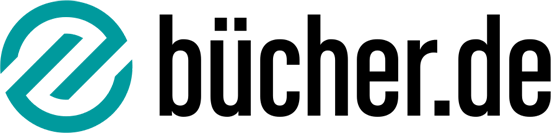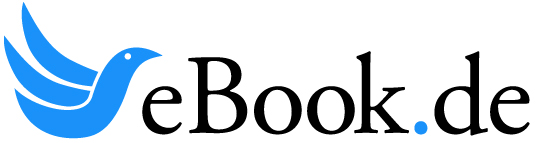paperback & ebook
Print: 978-3-86495-294-4
ebook: 978-3-86495-295-1
Print: 12,90 €[D]
ebook: 6,99 €[D]
The Bottom of my Heart
Annabel Rose
Inhaltsangabe
Als Jesse Fuller auf die temperamentvolle New Yorkerin Daisy trifft, sieht es nicht so aus, als ob ihre Begegnung unter einem günstigen Stern steht. Nicht nur, dass sie sich weigert, seine geldkräftige Offerte anzunehmen, als er ihr den Slogan ihres Deli Restaurants abkaufen will, nein, sie demütigt ihn obendrein noch in aller Öffentlichkeit.
Jesses Freundin und Geschäftspartnerin Carolyn macht sich Jesses verletze Gefühle zunutze und überredet ihn dazu, sich an Daisy zu rächen. Sein Vorhaben scheitert jedoch ein zweites Mal. Als Daisy seine Pläne durchschaut, ist sie ihrerseits darauf aus, Jesse Fuller einen Denkzettel zu verpassen. Doch anstatt es ihm heimzuzahlen, öffnet die devote Daisy ihm die Tür zur Welt der Dominanz und Hingabe.
Während sie sich mehr und mehr in ihn verliebt, fürchtet sie gleichzeitig um den Verlust seiner Liebe – denn Daisy enthält ihm eine Information vor, die alles ändern könnte und die zur tickenden Zeitbombe für ihre noch zerbrechliche Beziehung wird …
Ein romantischer BDSM-Roman.
Über die Autorin
Die Literaturwissenschaftlerin Annabel Rose kam erst über Umwege zum Schreiben erotischer Literatur. Warum ausgerechnet erotische Literatur? Weil ihrer Meinung nach Erotik und Sex wichtiger Bestandteil im Leben eines jeden Menschen ist.
Annabel Rose liebt Frankreich und den Süden, Katzen, intelligente Gespräche,...
mehr über die Autorin erfahren
Weitere Bücher der Autorin
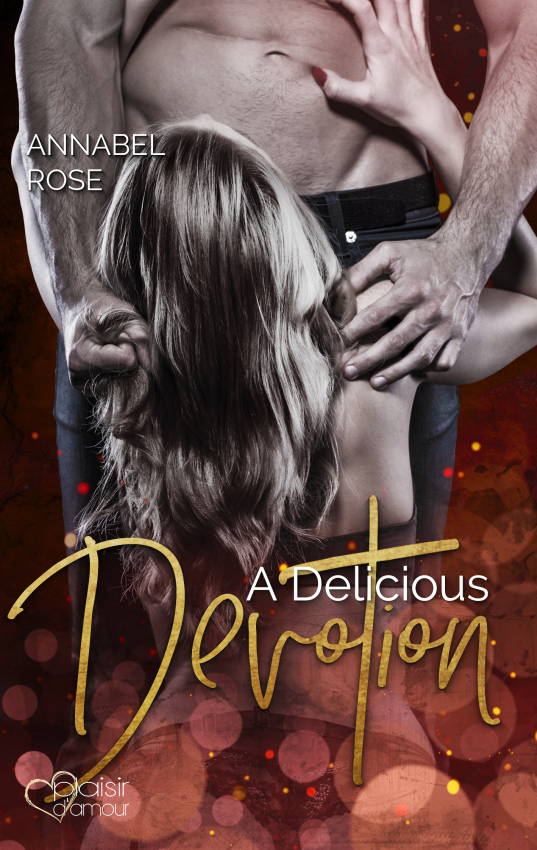
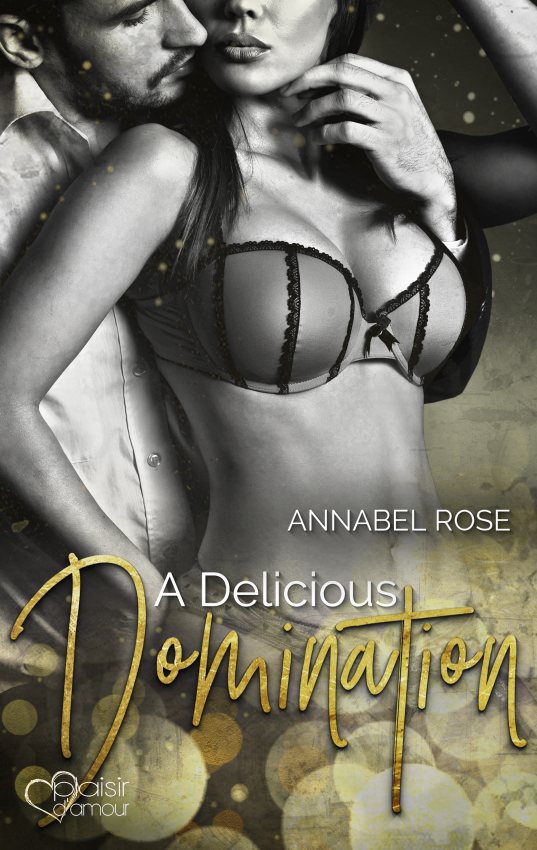


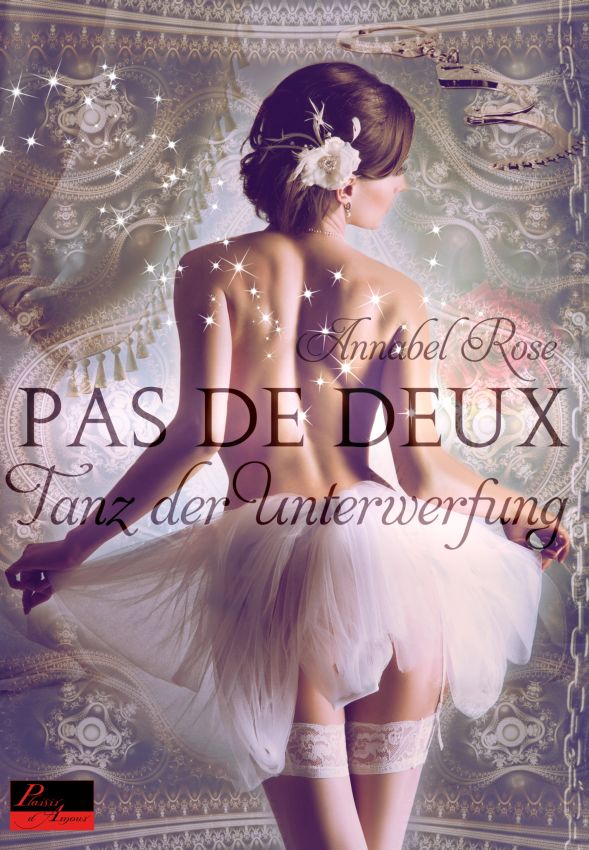
noch mehr
Leseprobe
XXL-Leseprobe bei Book2Look
Das Taxi hielt vor dem Hotel Lexington. Jesse bezahlte den Fahrer und stieg aus. Es regnete. Jesse seufzte, denn er hatte keinen Schirm dabei. Warum auch? In Kalifornien war Regen um diese Jahreszeit eine Seltenheit. Dass das auf New York nicht zutraf, daran hatte er nicht gedacht. Zum Glück waren es bis zum Hoteleingang nur ein paar Schritte. Jesse ergriff seinen Koffer und betrat die Eingangshalle. Nach wenigen Minuten hatte er eingecheckt und inspizierte das Zimmer. Es war nicht besonders groß, dafür aber sauber und modern eingerichtet. Ausreichend für das, was er vorhatte. Ein Grollen im Bauch...
vollständige Leseprobe
...ließ ihn auf die Uhr gucken. Halb neun. Zeit fürs Abendessen. Angesichts des Sauwetters beschloss Jesse, im Hotelrestaurant zu essen. New York lief nicht weg, die Stadt konnte er sich auch morgen ansehen.
Am nächsten Morgen regnete es immer noch, der Himmel war wolkenverhangen. Schien in dieser Stadt denn niemals die Sonne? Jesse ließ sich mit dem Taxi zu Bloomingdale’s bringen, das nur ein paar Straßen entfernt war. Als er dort ankam, war das Kaufhaus noch geschlossen. Gemeinsam mit anderen Kunden wartete er unter einem Vordach darauf, dass sich die Türen des Konsumtempels öffneten.
Punkt zehn Uhr war es so weit. Ein uniformierter Türsteher schloss auf und begrüßte die ersten Käufer mit einem freundlichen Gruß. Jesse betrat zusammen mit den anderen Leuten das Geschäft und versuchte, sich zu orientieren. Aus den Lautsprechern des Kaufhauses ertönten ein paar Takte Musik in markantem Rhythmus, bevor Frankies unverkennbare Stimme erklang: Start spreading the news. I’m leaving today. I want to be a part of it, New York, New York …
Auf der Suche nach dem nächsten Wegweiser bewegte Jesse sich mit zügigen Schritten durch die Parfümerieabteilung, bis er vor einem beleuchteten, aufragenden Paneel stand.
Regenschirme, Regenschirme, Regen… ah! Regenschirme gab es im Erdgeschoss. Aber wo in diesem unüberschaubaren Warendschungel? Sein Weg führte ihn an Ledertaschen berühmter Modedesigner vorbei und dann sah er sie: Regenschirme in allen Farben und Größen. Er entschied sich für einen schwarzen Stockschirm und begab sich schnurstracks zur Kasse.
If I can make it there, I’m gonna make it anywhere, schmetterte Frankie durch das Luxuskaufhaus.
Jesse nahm es als gutes Omen. Er zahlte und verließ das Geschäft.
Was faszinierte die Leute nur so an New York? Er spannte den Schirm auf und ging die Straße hinunter. Das Wetter war jedenfalls grauenvoll. Dabei war es erst September. Einer der schönsten und wärmsten Monate in Kalifornien. Hier dagegen quetschten sich die Leute mit den Regenschirmen aneinander vorbei, immer aufpassend, dass man sich nicht ins Gehege kam und einem der Wind nicht den Schirm aus der Hand riss.
Er stieg, den Regenschirm im Gehen zusammenfaltend, die Treppen zur New Yorker U-Bahn hinunter. Während der Fahrt hatte er genügend Zeit, um sich noch einmal zu überlegen, was er der Schrulle Marino sagen wollte. Er tastete nach dem Briefumschlag in der Innentasche seiner Jacke. Nur ein Volltrottel würde die Summe ablehnen, die auf dem Scheck stand, der sich darin befand.
An der Christopher Street verließ Jesse die Subway. Am Himmel zeigte sich eine Wolkenlücke. Die Sonne ließ sich blicken. Der Wind hatte die Regenwolken offenbar weggepustet.
Moment mal! Regen? Verdammt! Er hatte den Schirm in der U-Bahn liegen lassen. Jesse ärgerte sich über seine Nachlässigkeit. Verschwendung war ihm ein Gräuel.
Das Sonnenlicht blendete ihn. Zum Glück hatte er seine Sonnenbrille immer dabei. Er kramte sie aus seiner Innentasche hervor, setzte sie auf und knöpfte die Jeansjacke zu. Auch wenn die Sonne sich zeigte, war der Wind alles andere als warm. Ein Blick auf die Navigationsfunktion seines Handys genügte, um den Weg zu seiner Widersacherin zu erkennen. Jesse ging die Christopher Street ein Stück entlang und bog am Waverly Place rechts ab. Dieses Viertel sah gar nicht so aus wie das New York, das er aus dem Fernsehen und den Nachrichten kannte. Die Häuser aus rotem Backstein mit den schmiedeeisernen Balkonen und Feuerleitern an den Fassaden waren maximal sechs bis acht Stockwerke hoch. Geradezu winzig im Vergleich zu den Wolkenkratzern im nördlicheren Manhattan. Alles war hier etwas kleiner, beschaulicher, familiärer. Interessiert schlenderte Jesse an den vielen originellen Läden vorbei, an Restaurants und Bars mit teilweise deutlichem Gay-Touch. Dazwischen ein Friseursalon, eine Buchhandlung und – er wollte es kaum glauben – ein Schallplattenladen! Und allesamt sahen sie so aus, als ob die Zeit im letzten Jahrhundert stehen geblieben wäre. Bunt, schillernd und kreativ präsentierte sich das Viertel, ein bisschen wie die SoMa in San Francisco. Jesse fühlte sich beinahe heimisch. Er bog um die nächste Ecke in die Macdougal Street, wo das Deli der widerspenstigen alten Schachtel lag, das er wenige Augenblicke später erreichte.
Er blieb einen Moment vor dem Schaufenster stehen. Daisy’s Deli prangte in geschwungenen Buchstaben auf dem Schaufenster – mit einem Gänseblümchen als i in Daisy. Darunter etwas kleiner: delicious food to take-out or sit-down – und schließlich der verhasste Slogan: Delight, Delightfuller, Daisy’s.
Das Innere machte einen aufgeräumten Eindruck, trotz der kitschigen runden Tische auf der anderen Seite des Schaufensters, die ebenfalls den Gänseblümchen-Look trugen. Die Besitzerin hatte offenbar ihren Namen zum Motto des Geschäfts gemacht. Wie kindisch! Um jeden Tisch waren vier Stühle arrangiert, nur zwei Tische waren besetzt. Weiter hinten im Laden bediente eine Verkäuferin eine Kundin, die sich an einer Theke mit Käse- und Wurstspezialitäten beraten ließ; eine zweite Verkäuferin, eine attraktive Brünette, stand hinter einer weiteren Theke und sortierte das Gebäck in der Vitrine. Der Laden schien nicht gerade eine Goldgrube zu sein. Es sollte ein Leichtes sein, die alte Schnepfe davon zu überzeugen, sein Geld zu nehmen und auf ihren Wahlspruch zu verzichten. Allerdings war von der Schnepfe nichts zu sehen. Kein Problem! Bestimmt konnte ihm eine der beiden niedlichen Verkäuferinnen sagen, wo die Inhaberin zu finden war. Jesse war bereit. Er ergriff den Türknauf und betrat den Laden. Die Schlacht konnte beginnen.
»Probieren Sie unsere Fenchelsalami, Mrs. Coleman. Sie ist mit Chianti verfeinert. Ideal für Crostini oder Antipasti …«
Die Kundin nahm die Kostprobe entgegen, Jesse wandte sich der dunkelhaarigen Verkäuferin zu. Sie drehte ihm gerade den Rücken zu und holte Bagels und Donuts aus einem Korb. Jesses Blick fiel unfreiwillig auf ihre schmale Taille und den wohlgeformten Hintern. Nicht zu verachten, die Kleine, dachte er und fand seine Gedanken bestätigt, als sie ihm ihre Vorderseite zuwandte. Lange braune Haare umschlossen ein ovales Gesicht, aus dem zwei meeresblaue Augen herausschauten, die lebhaft leuchteten.
»Womit kann ich Ihnen helfen, Sir?«, klang eine melodiöse Stimme aus dem herzförmigen Mund.
»Kann ich einen Kaffee bekommen?«
Er schob die Sonnenbrille über die Stirn ins Haar und betrachtete sie genauer. Sein Blick glitt über den Ausschnitt ihrer Bluse, aus dem der Ansatz ihres Dekolletés herausschaute. Reizend! Er bemerkte, dass ihr Mund ein Stück aufklappte. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Wollte sie ihn anmachen? Das war gar nicht nötig. Er fand sie auch so ausgesprochen anziehend.
»Selbstverständlich … Sir«, antwortete die liebliche Stimme, ihre Augen allerdings starrten ihn an, als hätte sie einen Geist gesehen. Sie stand wie festgewachsen und bewegte sich keinen Zentimeter vom Fleck.
»Ist alles in Ordnung, Miss? Oder fühlen Sie sich nicht wohl?«, erkundigte er sich vorsichtshalber.
Sie schien seine Frage nicht gehört zu haben, denn sie ging nicht darauf ein.
Stattdessen sagte sie: »Sie … Sie … haben braune Augen. Ha… ha… haselnussbraune Augen.«
Er lächelte sie an. »Ist das ein Verbrechen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie sind mein Traum …«, fuhr sie fort und lief rot an. »Ich meine … ich meine … ich habe von Ihnen geträumt. Also nicht so, aber … die Sonnenbrille. Und Sie. Im Traum … Ich habe davon geträumt. Verstehen Sie …?«
Je mehr sie sich verhaspelte, umso breiter wurde sein Grinsen. War sie nicht süß? Es war lange her, dass er eine Frau nur durch Blickkontakt so sehr aus dem Konzept gebracht hatte. Die rosigen Wangen standen ihr übrigens ausgezeichnet. Und wenn er sich nicht irrte, dann wäre es ein Kinderspiel, die kleine Maus für heute Abend einzuladen – und vielleicht nähme dieser Abend ja noch eine ganz andere Wendung. Eine, zu der er – angesichts von Carolyns eisiger Zurückhaltung in der letzten Zeit – sicher nicht Nein sagen würde. Ihm lief bereits das Wasser im Munde zusammen, wenn er daran dachte, wie es sich anfühlen musste, ihre zweifelsohne üppigen Brüste in den Händen zu halten oder sich in ihren entzückenden runden Hintern zu krallen, während er tief in sie stieß und ihr bezaubernder Kussmund Laute hervorbrachte, die seinen Schwanz explodieren lassen würden.
»Ehrlich gesagt, ich verstehe kein Wort«, gab er zu. »Aber ich hätte nichts dagegen, wenn Sie es mir erklären würden. Vielleicht heute Abend? Beim Essen?«
»Beim Essen?«, wiederholte sie, als hätte sie ihn nicht richtig verstanden. »Das … das geht nicht.«
»Warum denn nicht?«, insistierte er. »Hat Ihre Chefin Ihnen etwa verboten, Einladungen von Kunden anzunehmen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Sir.«
»Ah, jetzt weiß ich: Sie haben einen Freund und der hat etwas dagegen, wenn Sie mit fremden Männern ausgehen. Das verstehe ich natürlich.« Er beugte sich ein Stück über die Theke zu ihr hinüber und flüsterte: «Wenn ich er wäre, hätte ich auch etwas dagegen.«
Sie wurde noch einen Tick roter und schüttelte wieder den Kopf. »Nein, das ist es nicht …«
»Nein? Kein Freund? Dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht.« An der Art und Weise, wie sie ihn ansah, bemerkte er, dass sie kurz davor war, Ja zu sagen. Um ihr den letzten Schubs in die richtige Richtung zu verpassen, entschloss er sich zu einer Notlüge. »Kommen Sie. Geben Sie mir eine Chance. Ich bin neu in der Stadt und kenne sonst niemanden. Leisten Sie mir an meinem ersten Abend in New York Gesellschaft. Bitte!« Er fixierte sie mit den Augen. »Wäre das wirklich so schlimm?«
»Nein.«
Sie wich seinem Blick aus, schaute ihn dann aber wieder an. Oh Mann! Dieser Augenaufschlag! Was würde er dafür geben, wenn sie ihm dabei einen blasen würde!
»Aber … Sie können mich doch nicht einfach zum Essen einladen. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht.«
»Genau deshalb möchte ich Sie ja einladen. Um Sie kennenzulernen. Und wissen Sie was? Wir fangen am besten sofort damit an.« Er streckte ihr die Hand über den Tresen entgegen. »Ich bin Jesse. Jesse Fuller. Und wie heißen Sie?«
Sie sah aus, als würde sie aus einem Traum erwachen. Die blauen Augen funkelten ihn an, die Pupillen hatten sich zu kleinen Punkten zusammengezogen, die Stirn war gerunzelt.
»Mister … Fuller«, wiederholte sie tonlos. »Jesse Fuller?«
»Ja, richtig.« Er hielt ihr immer noch die ausgestreckte Hand hin. Was war denn auf einmal mit ihr los?
»Sie sind Jesse Fuller?«, fragte sie mit einem scharfen Unterton, jedes Wort dabei betonend.
Irgendetwas stimmte hier nicht. Er zog die Hand zurück.
»Ja. Und verraten Sie mir auch Ihren Namen?«
»Rachel«, sagte sie laut und deutlich zu der Verkäuferin am anderen Ende der Theke, »weißt du, wer das ist?« Sie wartete Rachels Antwort nicht ab, sondern fuhr fort: »Das ist Mr. Jesse Fuller aus San Francisco. Mr. Fuller, dessen Anwalt mir seit Monaten Briefe schreibt, in denen er behauptet, unser Slogan schädige den Ruf von Mr. Fuller, und wir sollten uns deshalb einen anderen überlegen.«
Erstauntes Gemurmel erklang hinter Jesses Rücken. Verwundert bemerkte er, dass sich während des Flirts mit der niedlichen Verkäuferin eine Schlange in dem Laden gebildet hatte.
»Miss … Da Sie offenbar gut informiert sind, sollten wir nicht besser in Ruhe …«
»Mrs. für Sie!«, unterbrach sie ihn. »Mrs. Marino, um genau zu sein.«
»Mrs. … Marino …« Er verschluckte sich fast an dem Wort, dann – mit einer Sekunde Verzögerung – kam die Information in seinem Hirn an. OH SHIT! »Sie sind Daisy Marino? Die Inhaberin?«
»Sehr richtig. Höchstpersönlich, live und in Farbe. Und ich würde vorschlagen, dass Sie sagen, weshalb Sie hergekommen sind, denn wie Sie sehen, habe ich Kunden zu bedienen.«
Verdammt! Das mit dem Essen und dem Sex danach konnte er wohl abhaken.
»Mrs. Marino«, versuchte er, sie zu beschwichtigen, »sollten wir die Angelegenheit nicht besser in Ruhe in Ihrem Büro …«
»Mr. Fuller!«, unterbrach sie ihn ungehalten. »Es tut mir leid, aber ich habe nicht so viel Zeit. Kommen Sie lieber zur Sache. Also: Weshalb sind Sie hergekommen?«
Es war so still im Geschäft, dass man den Flügelschlag eines Schmetterlings hätte hören können. Keiner der Anwesenden schien auch nur das Geringste von dem, was jetzt passieren sollte, verpassen zu wollen. Jesse kam sich vor wie in einem Thriller, kurz vor dem Showdown. Er sah ein, dass ihm nicht viele Möglichkeiten blieben. Aber einen Trumpf hatte er noch im Ärmel. Oder besser gesagt in der Jackentasche.
»Na schön. Meine Forderung kennen Sie. Ich bleibe dabei. Und vielleicht …«, er zog den Umschlag aus dem Innenfutter der Jacke, »hilft Ihnen das hier ja, Ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.«
Sie nahm den Umschlag mit einem spöttischen Blick entgegen, öffnete ihn und holte den Scheck heraus. Die Veränderung ihres Gesichtsausdrucks war eine Genugtuung für Jesses angekratztes Ego. Ihr Mund klappte auf, und die Augen funkelten und glänzten so sehr, dass er hätte schwören können, darin Dollarzeichen zu erkennen. Jeder hatte eben seinen Preis. Und Jesse hatte sein letztes Angebot nicht nur leicht erhöht, sondern er hatte es verdoppelt. Einhundertfünfzigtausend Dollar. Eine verflucht hohe Summe. Mehr als er je zu bieten beabsichtigt hatte. Aber hier ging es ums Prinzip – und um seinen Stolz. Der Blick in das Gesicht von Daisy Marino war jedoch jeden Cent wert. Selbst ein Blinder hätte erkannt, dass Miss Zicke Marino ins Wanken geriet und der Versuchung des Geldes nur noch schwer widerstehen konnte. Genau der richtige Zeitpunkt, um ihr den letzten Stoß zu verpassen.
»Bedenken Sie, was Sie damit alles tun könnten«, raunte er ihr vertrauensvoll zu.
Sie schluckte, nickte kaum merklich. Offenbar hatte es ihr die Sprache verschlagen.
Er setzte noch einen drauf: »Vielleicht die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches?«
Sie sah ihn mit großen Augen an. Bingo! Er hatte ins Schwarze getroffen. Ihre Lippen zitterten. Gleich würde sie Ja sagen.
»Das ist wirklich … sehr viel Geld«, sagte sie kleinlaut. »Sehr, sehr viel Geld.«
Er spürte, wie die Luft vor Spannung knisterte. Das ganze Lokal hielt den Atem an. Alle warteten darauf, welche Entscheidung sie treffen würde, als plötzlich Unruhe in der Schlange entstand.
»Lasst mich durch«, hörte Jesse eine kratzige, raue Stimme vom anderen Ende des Geschäfts. »Lasst mich doch mal durch.« Die Stimme kam näher. »Was ist hier los, Miss Daisy? Wieso geht es nicht weiter? Die Leute wollen bedient werden.«
Jesse erblickte einen Mann, den er auf Mitte fünfzig schätzte. Er trug einen verschlissenen Tweedmantel und eine abgewetzte Jeans. Sein graues Haar war strubbelig und hing ihm ins Gesicht, der Bart war ungepflegt und hatte eine Rasur mehr als nötig – und wenn sich seine Nase nicht täuschte, dann könnte der Typ neben ihm außerdem dringend ein Bad vertragen. Was hatte der Kerl hier verloren? Und was fiel ihm ein, sich ungefragt vorzudrängeln und das Gespräch zu unterbrechen?
»Ich glaube, das geht Sie nichts an«, sagte er bestimmend zu dem Grauhaarigen. »Ich führe hier gerade ein wichtiges Gespräch mit Mrs. Marino. Und …«
»Hat er Sie belästigt, Miss Daisy? Soll ich den Lackaffen rausschmeißen?«, unterbrach ihn der Alte.
Lackaffe? Hatte der Penner ihn Lackaffe genannt? Jesses Puls schoss in die Höhe. Stünde nicht so viel auf dem Spiel, würde er dem Kerl zeigen, wo der Hammer hing. Er ballte die Fäuste zusammen und presste die Kiefer gegeneinander. Noch ein Wort von dem stinkenden Ungeheuer und er wäre am Ende seiner Geduld. Unter Aufbietung aller Selbstbeherrschung strafte er den Alten mit einem verächtlichen Blick und wandte sich wieder der Inhaberin zu.
»Ich glaube, Sie wollten etwas sagen, bevor wir … unterbrochen wurden. Also: Nehmen Sie mein Angebot an?«
»Nun ja, ich muss sagen, es ist wirklich überaus großzügig … mit so einer Summe könnte ich …«
»Miss Daisy …«
Der Alte versuchte schon wieder, sich dazwischenzudrängen, doch dieses Mal ließ Jesse sich von dem Pennbruder nicht ausbremsen: »Greifen Sie zu. Je eher Sie Ja sagen, umso schneller sind Sie mich los und umso schneller können Sie Ihre Kunden bedienen.« Bei dem letzten Satz warf er einen abschätzigen Blick auf den Mann neben sich und fügte leise murmelnd hinzu: »Wobei man bei einem Penner ja wohl schwerlich von Kunde reden kann.«
Er hatte die Worte kaum ausgesprochen, als er bemerkte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Mrs. Marino bedachte ihn mit einem Blick, der ihn auf der Stelle hätte tot umfallen lassen, wenn das möglich gewesen wäre.
»Wie haben Sie Henry gerade genannt?«, fragte sie mit einem scharfen Unterton. »Henry ist kein Penner, sondern obdachlos. Und das ist er nicht ohne Grund. Darüber hinaus ist er mein Freund und Stammkunde.«
Er wollte etwas erwidern, doch sie hatte sich derart in Rage geredet, dass sie nicht zu bremsen war.
»Denken Sie etwa, Henry nimmt Almosen von mir an? Dazu ist er viel zu stolz. Er bezahlt wie jeder andere hier, und zwar mit Hilfsbereitschaft. Eine Währung, die Ihnen vermutlich unbekannt ist, Mr. Fuller. Sie denken wahrscheinlich, dass Sie mit einem netten Lächeln und Geld alles kaufen können. Wissen Sie was?« Sie wedelte mit dem Scheck vor seiner Nase herum. »Stecken Sie sich Ihre Dollars sonst wo hin!« Sie zerriss das Papier vor den Augen aller Anwesenden in kleine Fetzen und warf sie mit einer theatralischen Handbewegung in die Luft. »Mich können Sie jedenfalls nicht kaufen. Guten Tag, Mr. Fuller!«
Ein Johlen und Pfeifen setzte in dem Geschäft ein, einige Kunden applaudierten, viele lachten oder grinsten. Jesse hatte gepokert – und haushoch verloren. Die Niederlage war bitter. Er wusste, dass er nur einen Hauch vom Sieg entfernt gewesen war. Wenn ihm nur dieser verdammte Penner nicht dazwischengefunkt hätte … Stattdessen hatte die Kleine ihn gedemütigt. Ihn. Jesse Fuller. Und obendrein vor allen Leuten! Wenn sie glaubte, dass damit das letzte Wort gesprochen war, irrte sie sich gewaltig.
»Das wird Ihnen noch leidtun«, sagte er frostig und verließ mit erhobenem Haupt das Geschäft.
Das Taxi hielt vor dem Hotel Lexington. Jesse bezahlte den Fahrer und stieg aus. Es regnete. Jesse seufzte, denn er hatte keinen Schirm dabei. Warum auch? In Kalifornien war Regen um diese Jahreszeit eine Seltenheit. Dass das auf New York nicht zutraf, daran hatte er nicht gedacht. Zum Glück waren es bis zum Hoteleingang nur ein paar Schritte. Jesse ergriff seinen Koffer und betrat die Eingangshalle. Nach wenigen Minuten hatte er eingecheckt und inspizierte das Zimmer. Es war nicht besonders groß, dafür aber sauber und modern eingerichtet. Ausreichend für das, was er vorhatte. Ein Grollen im Bauch ließ ihn auf die Uhr gucken. Halb neun. Zeit fürs Abendessen. Angesichts des Sauwetters beschloss Jesse, im Hotelrestaurant zu essen. New York lief nicht weg, die Stadt konnte er sich auch morgen ansehen.
Am nächsten Morgen regnete es immer noch, der Himmel war wolkenverhangen. Schien in dieser Stadt denn niemals die Sonne? Jesse ließ sich mit dem Taxi zu Bloomingdale’s bringen, das nur ein paar Straßen entfernt war. Als er dort ankam, war das Kaufhaus noch geschlossen. Gemeinsam mit anderen Kunden wartete er unter einem Vordach darauf, dass sich die Türen des Konsumtempels öffneten.
Punkt zehn Uhr war es so weit. Ein uniformierter Türsteher schloss auf und begrüßte die ersten Käufer mit einem freundlichen Gruß. Jesse betrat zusammen mit den anderen Leuten das Geschäft und versuchte, sich zu orientieren. Aus den Lautsprechern des Kaufhauses ertönten ein paar Takte Musik in markantem Rhythmus, bevor Frankies unverkennbare Stimme erklang: Start spreading the news. I’m leaving today. I want to be a part of it, New York, New York …
Auf der Suche nach dem nächsten Wegweiser bewegte Jesse sich mit zügigen Schritten durch die Parfümerieabteilung, bis er vor einem beleuchteten, aufragenden Paneel stand.
Regenschirme, Regenschirme, Regen… ah! Regenschirme gab es im Erdgeschoss. Aber wo in diesem unüberschaubaren Warendschungel? Sein Weg führte ihn an Ledertaschen berühmter Modedesigner vorbei und dann sah er sie: Regenschirme in allen Farben und Größen. Er entschied sich für einen schwarzen Stockschirm und begab sich schnurstracks zur Kasse.
If I can make it there, I’m gonna make it anywhere, schmetterte Frankie durch das Luxuskaufhaus.
Jesse nahm es als gutes Omen. Er zahlte und verließ das Geschäft.
Was faszinierte die Leute nur so an New York? Er spannte den Schirm auf und ging die Straße hinunter. Das Wetter war jedenfalls grauenvoll. Dabei war es erst September. Einer der schönsten und wärmsten Monate in Kalifornien. Hier dagegen quetschten sich die Leute mit den Regenschirmen aneinander vorbei, immer aufpassend, dass man sich nicht ins Gehege kam und einem der Wind nicht den Schirm aus der Hand riss.
Er stieg, den Regenschirm im Gehen zusammenfaltend, die Treppen zur New Yorker U-Bahn hinunter. Während der Fahrt hatte er genügend Zeit, um sich noch einmal zu überlegen, was er der Schrulle Marino sagen wollte. Er tastete nach dem Briefumschlag in der Innentasche seiner Jacke. Nur ein Volltrottel würde die Summe ablehnen, die auf dem Scheck stand, der sich darin befand.
An der Christopher Street verließ Jesse die Subway. Am Himmel zeigte sich eine Wolkenlücke. Die Sonne ließ sich blicken. Der Wind hatte die Regenwolken offenbar weggepustet.
Moment mal! Regen? Verdammt! Er hatte den Schirm in der U-Bahn liegen lassen. Jesse ärgerte sich über seine Nachlässigkeit. Verschwendung war ihm ein Gräuel.
Das Sonnenlicht blendete ihn. Zum Glück hatte er seine Sonnenbrille immer dabei. Er kramte sie aus seiner Innentasche hervor, setzte sie auf und knöpfte die Jeansjacke zu. Auch wenn die Sonne sich zeigte, war der Wind alles andere als warm. Ein Blick auf die Navigationsfunktion seines Handys genügte, um den Weg zu seiner Widersacherin zu erkennen. Jesse ging die Christopher Street ein Stück entlang und bog am Waverly Place rechts ab. Dieses Viertel sah gar nicht so aus wie das New York, das er aus dem Fernsehen und den Nachrichten kannte. Die Häuser aus rotem Backstein mit den schmiedeeisernen Balkonen und Feuerleitern an den Fassaden waren maximal sechs bis acht Stockwerke hoch. Geradezu winzig im Vergleich zu den Wolkenkratzern im nördlicheren Manhattan. Alles war hier etwas kleiner, beschaulicher, familiärer. Interessiert schlenderte Jesse an den vielen originellen Läden vorbei, an Restaurants und Bars mit teilweise deutlichem Gay-Touch. Dazwischen ein Friseursalon, eine Buchhandlung und – er wollte es kaum glauben – ein Schallplattenladen! Und allesamt sahen sie so aus, als ob die Zeit im letzten Jahrhundert stehen geblieben wäre. Bunt, schillernd und kreativ präsentierte sich das Viertel, ein bisschen wie die SoMa in San Francisco. Jesse fühlte sich beinahe heimisch. Er bog um die nächste Ecke in die Macdougal Street, wo das Deli der widerspenstigen alten Schachtel lag, das er wenige Augenblicke später erreichte.
Er blieb einen Moment vor dem Schaufenster stehen. Daisy’s Deli prangte in geschwungenen Buchstaben auf dem Schaufenster – mit einem Gänseblümchen als i in Daisy. Darunter etwas kleiner: delicious food to take-out or sit-down – und schließlich der verhasste Slogan: Delight, Delightfuller, Daisy’s.
Das Innere machte einen aufgeräumten Eindruck, trotz der kitschigen runden Tische auf der anderen Seite des Schaufensters, die ebenfalls den Gänseblümchen-Look trugen. Die Besitzerin hatte offenbar ihren Namen zum Motto des Geschäfts gemacht. Wie kindisch! Um jeden Tisch waren vier Stühle arrangiert, nur zwei Tische waren besetzt. Weiter hinten im Laden bediente eine Verkäuferin eine Kundin, die sich an einer Theke mit Käse- und Wurstspezialitäten beraten ließ; eine zweite Verkäuferin, eine attraktive Brünette, stand hinter einer weiteren Theke und sortierte das Gebäck in der Vitrine. Der Laden schien nicht gerade eine Goldgrube zu sein. Es sollte ein Leichtes sein, die alte Schnepfe davon zu überzeugen, sein Geld zu nehmen und auf ihren Wahlspruch zu verzichten. Allerdings war von der Schnepfe nichts zu sehen. Kein Problem! Bestimmt konnte ihm eine der beiden niedlichen Verkäuferinnen sagen, wo die Inhaberin zu finden war. Jesse war bereit. Er ergriff den Türknauf und betrat den Laden. Die Schlacht konnte beginnen.
»Probieren Sie unsere Fenchelsalami, Mrs. Coleman. Sie ist mit Chianti verfeinert. Ideal für Crostini oder Antipasti …«
Die Kundin nahm die Kostprobe entgegen, Jesse wandte sich der dunkelhaarigen Verkäuferin zu. Sie drehte ihm gerade den Rücken zu und holte Bagels und Donuts aus einem Korb. Jesses Blick fiel unfreiwillig auf ihre schmale Taille und den wohlgeformten Hintern. Nicht zu verachten, die Kleine, dachte er und fand seine Gedanken bestätigt, als sie ihm ihre Vorderseite zuwandte. Lange braune Haare umschlossen ein ovales Gesicht, aus dem zwei meeresblaue Augen herausschauten, die lebhaft leuchteten.
»Womit kann ich Ihnen helfen, Sir?«, klang eine melodiöse Stimme aus dem herzförmigen Mund.
»Kann ich einen Kaffee bekommen?«
Er schob die Sonnenbrille über die Stirn ins Haar und betrachtete sie genauer. Sein Blick glitt über den Ausschnitt ihrer Bluse, aus dem der Ansatz ihres Dekolletés herausschaute. Reizend! Er bemerkte, dass ihr Mund ein Stück aufklappte. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Wollte sie ihn anmachen? Das war gar nicht nötig. Er fand sie auch so ausgesprochen anziehend.
»Selbstverständlich … Sir«, antwortete die liebliche Stimme, ihre Augen allerdings starrten ihn an, als hätte sie einen Geist gesehen. Sie stand wie festgewachsen und bewegte sich keinen Zentimeter vom Fleck.
»Ist alles in Ordnung, Miss? Oder fühlen Sie sich nicht wohl?«, erkundigte er sich vorsichtshalber.
Sie schien seine Frage nicht gehört zu haben, denn sie ging nicht darauf ein.
Stattdessen sagte sie: »Sie … Sie … haben braune Augen. Ha… ha… haselnussbraune Augen.«
Er lächelte sie an. »Ist das ein Verbrechen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie sind mein Traum …«, fuhr sie fort und lief rot an. »Ich meine … ich meine … ich habe von Ihnen geträumt. Also nicht so, aber … die Sonnenbrille. Und Sie. Im Traum … Ich habe davon geträumt. Verstehen Sie …?«
Je mehr sie sich verhaspelte, umso breiter wurde sein Grinsen. War sie nicht süß? Es war lange her, dass er eine Frau nur durch Blickkontakt so sehr aus dem Konzept gebracht hatte. Die rosigen Wangen standen ihr übrigens ausgezeichnet. Und wenn er sich nicht irrte, dann wäre es ein Kinderspiel, die kleine Maus für heute Abend einzuladen – und vielleicht nähme dieser Abend ja noch eine ganz andere Wendung. Eine, zu der er – angesichts von Carolyns eisiger Zurückhaltung in der letzten Zeit – sicher nicht Nein sagen würde. Ihm lief bereits das Wasser im Munde zusammen, wenn er daran dachte, wie es sich anfühlen musste, ihre zweifelsohne üppigen Brüste in den Händen zu halten oder sich in ihren entzückenden runden Hintern zu krallen, während er tief in sie stieß und ihr bezaubernder Kussmund Laute hervorbrachte, die seinen Schwanz explodieren lassen würden.
»Ehrlich gesagt, ich verstehe kein Wort«, gab er zu. »Aber ich hätte nichts dagegen, wenn Sie es mir erklären würden. Vielleicht heute Abend? Beim Essen?«
»Beim Essen?«, wiederholte sie, als hätte sie ihn nicht richtig verstanden. »Das … das geht nicht.«
»Warum denn nicht?«, insistierte er. »Hat Ihre Chefin Ihnen etwa verboten, Einladungen von Kunden anzunehmen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Sir.«
»Ah, jetzt weiß ich: Sie haben einen Freund und der hat etwas dagegen, wenn Sie mit fremden Männern ausgehen. Das verstehe ich natürlich.« Er beugte sich ein Stück über die Theke zu ihr hinüber und flüsterte: «Wenn ich er wäre, hätte ich auch etwas dagegen.«
Sie wurde noch einen Tick roter und schüttelte wieder den Kopf. »Nein, das ist es nicht …«
»Nein? Kein Freund? Dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht.« An der Art und Weise, wie sie ihn ansah, bemerkte er, dass sie kurz davor war, Ja zu sagen. Um ihr den letzten Schubs in die richtige Richtung zu verpassen, entschloss er sich zu einer Notlüge. »Kommen Sie. Geben Sie mir eine Chance. Ich bin neu in der Stadt und kenne sonst niemanden. Leisten Sie mir an meinem ersten Abend in New York Gesellschaft. Bitte!« Er fixierte sie mit den Augen. »Wäre das wirklich so schlimm?«
»Nein.«
Sie wich seinem Blick aus, schaute ihn dann aber wieder an. Oh Mann! Dieser Augenaufschlag! Was würde er dafür geben, wenn sie ihm dabei einen blasen würde!
»Aber … Sie können mich doch nicht einfach zum Essen einladen. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht.«
»Genau deshalb möchte ich Sie ja einladen. Um Sie kennenzulernen. Und wissen Sie was? Wir fangen am besten sofort damit an.« Er streckte ihr die Hand über den Tresen entgegen. »Ich bin Jesse. Jesse Fuller. Und wie heißen Sie?«
Sie sah aus, als würde sie aus einem Traum erwachen. Die blauen Augen funkelten ihn an, die Pupillen hatten sich zu kleinen Punkten zusammengezogen, die Stirn war gerunzelt.
»Mister … Fuller«, wiederholte sie tonlos. »Jesse Fuller?«
»Ja, richtig.« Er hielt ihr immer noch die ausgestreckte Hand hin. Was war denn auf einmal mit ihr los?
»Sie sind Jesse Fuller?«, fragte sie mit einem scharfen Unterton, jedes Wort dabei betonend.
Irgendetwas stimmte hier nicht. Er zog die Hand zurück.
»Ja. Und verraten Sie mir auch Ihren Namen?«
»Rachel«, sagte sie laut und deutlich zu der Verkäuferin am anderen Ende der Theke, »weißt du, wer das ist?« Sie wartete Rachels Antwort nicht ab, sondern fuhr fort: »Das ist Mr. Jesse Fuller aus San Francisco. Mr. Fuller, dessen Anwalt mir seit Monaten Briefe schreibt, in denen er behauptet, unser Slogan schädige den Ruf von Mr. Fuller, und wir sollten uns deshalb einen anderen überlegen.«
Erstauntes Gemurmel erklang hinter Jesses Rücken. Verwundert bemerkte er, dass sich während des Flirts mit der niedlichen Verkäuferin eine Schlange in dem Laden gebildet hatte.
»Miss … Da Sie offenbar gut informiert sind, sollten wir nicht besser in Ruhe …«
»Mrs. für Sie!«, unterbrach sie ihn. »Mrs. Marino, um genau zu sein.«
»Mrs. … Marino …« Er verschluckte sich fast an dem Wort, dann – mit einer Sekunde Verzögerung – kam die Information in seinem Hirn an. OH SHIT! »Sie sind Daisy Marino? Die Inhaberin?«
»Sehr richtig. Höchstpersönlich, live und in Farbe. Und ich würde vorschlagen, dass Sie sagen, weshalb Sie hergekommen sind, denn wie Sie sehen, habe ich Kunden zu bedienen.«
Verdammt! Das mit dem Essen und dem Sex danach konnte er wohl abhaken.
»Mrs. Marino«, versuchte er, sie zu beschwichtigen, »sollten wir die Angelegenheit nicht besser in Ruhe in Ihrem Büro …«
»Mr. Fuller!«, unterbrach sie ihn ungehalten. »Es tut mir leid, aber ich habe nicht so viel Zeit. Kommen Sie lieber zur Sache. Also: Weshalb sind Sie hergekommen?«
Es war so still im Geschäft, dass man den Flügelschlag eines Schmetterlings hätte hören können. Keiner der Anwesenden schien auch nur das Geringste von dem, was jetzt passieren sollte, verpassen zu wollen. Jesse kam sich vor wie in einem Thriller, kurz vor dem Showdown. Er sah ein, dass ihm nicht viele Möglichkeiten blieben. Aber einen Trumpf hatte er noch im Ärmel. Oder besser gesagt in der Jackentasche.
»Na schön. Meine Forderung kennen Sie. Ich bleibe dabei. Und vielleicht …«, er zog den Umschlag aus dem Innenfutter der Jacke, »hilft Ihnen das hier ja, Ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.«
Sie nahm den Umschlag mit einem spöttischen Blick entgegen, öffnete ihn und holte den Scheck heraus. Die Veränderung ihres Gesichtsausdrucks war eine Genugtuung für Jesses angekratztes Ego. Ihr Mund klappte auf, und die Augen funkelten und glänzten so sehr, dass er hätte schwören können, darin Dollarzeichen zu erkennen. Jeder hatte eben seinen Preis. Und Jesse hatte sein letztes Angebot nicht nur leicht erhöht, sondern er hatte es verdoppelt. Einhundertfünfzigtausend Dollar. Eine verflucht hohe Summe. Mehr als er je zu bieten beabsichtigt hatte. Aber hier ging es ums Prinzip – und um seinen Stolz. Der Blick in das Gesicht von Daisy Marino war jedoch jeden Cent wert. Selbst ein Blinder hätte erkannt, dass Miss Zicke Marino ins Wanken geriet und der Versuchung des Geldes nur noch schwer widerstehen konnte. Genau der richtige Zeitpunkt, um ihr den letzten Stoß zu verpassen.
»Bedenken Sie, was Sie damit alles tun könnten«, raunte er ihr vertrauensvoll zu.
Sie schluckte, nickte kaum merklich. Offenbar hatte es ihr die Sprache verschlagen.
Er setzte noch einen drauf: »Vielleicht die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches?«
Sie sah ihn mit großen Augen an. Bingo! Er hatte ins Schwarze getroffen. Ihre Lippen zitterten. Gleich würde sie Ja sagen.
»Das ist wirklich … sehr viel Geld«, sagte sie kleinlaut. »Sehr, sehr viel Geld.«
Er spürte, wie die Luft vor Spannung knisterte. Das ganze Lokal hielt den Atem an. Alle warteten darauf, welche Entscheidung sie treffen würde, als plötzlich Unruhe in der Schlange entstand.
»Lasst mich durch«, hörte Jesse eine kratzige, raue Stimme vom anderen Ende des Geschäfts. »Lasst mich doch mal durch.« Die Stimme kam näher. »Was ist hier los, Miss Daisy? Wieso geht es nicht weiter? Die Leute wollen bedient werden.«
Jesse erblickte einen Mann, den er auf Mitte fünfzig schätzte. Er trug einen verschlissenen Tweedmantel und eine abgewetzte Jeans. Sein graues Haar war strubbelig und hing ihm ins Gesicht, der Bart war ungepflegt und hatte eine Rasur mehr als nötig – und wenn sich seine Nase nicht täuschte, dann könnte der Typ neben ihm außerdem dringend ein Bad vertragen. Was hatte der Kerl hier verloren? Und was fiel ihm ein, sich ungefragt vorzudrängeln und das Gespräch zu unterbrechen?
»Ich glaube, das geht Sie nichts an«, sagte er bestimmend zu dem Grauhaarigen. »Ich führe hier gerade ein wichtiges Gespräch mit Mrs. Marino. Und …«
»Hat er Sie belästigt, Miss Daisy? Soll ich den Lackaffen rausschmeißen?«, unterbrach ihn der Alte.
Lackaffe? Hatte der Penner ihn Lackaffe genannt? Jesses Puls schoss in die Höhe. Stünde nicht so viel auf dem Spiel, würde er dem Kerl zeigen, wo der Hammer hing. Er ballte die Fäuste zusammen und presste die Kiefer gegeneinander. Noch ein Wort von dem stinkenden Ungeheuer und er wäre am Ende seiner Geduld. Unter Aufbietung aller Selbstbeherrschung strafte er den Alten mit einem verächtlichen Blick und wandte sich wieder der Inhaberin zu.
»Ich glaube, Sie wollten etwas sagen, bevor wir … unterbrochen wurden. Also: Nehmen Sie mein Angebot an?«
»Nun ja, ich muss sagen, es ist wirklich überaus großzügig … mit so einer Summe könnte ich …«
»Miss Daisy …«
Der Alte versuchte schon wieder, sich dazwischenzudrängen, doch dieses Mal ließ Jesse sich von dem Pennbruder nicht ausbremsen: »Greifen Sie zu. Je eher Sie Ja sagen, umso schneller sind Sie mich los und umso schneller können Sie Ihre Kunden bedienen.« Bei dem letzten Satz warf er einen abschätzigen Blick auf den Mann neben sich und fügte leise murmelnd hinzu: »Wobei man bei einem Penner ja wohl schwerlich von Kunde reden kann.«
Er hatte die Worte kaum ausgesprochen, als er bemerkte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Mrs. Marino bedachte ihn mit einem Blick, der ihn auf der Stelle hätte tot umfallen lassen, wenn das möglich gewesen wäre.
»Wie haben Sie Henry gerade genannt?«, fragte sie mit einem scharfen Unterton. »Henry ist kein Penner, sondern obdachlos. Und das ist er nicht ohne Grund. Darüber hinaus ist er mein Freund und Stammkunde.«
Er wollte etwas erwidern, doch sie hatte sich derart in Rage geredet, dass sie nicht zu bremsen war.
»Denken Sie etwa, Henry nimmt Almosen von mir an? Dazu ist er viel zu stolz. Er bezahlt wie jeder andere hier, und zwar mit Hilfsbereitschaft. Eine Währung, die Ihnen vermutlich unbekannt ist, Mr. Fuller. Sie denken wahrscheinlich, dass Sie mit einem netten Lächeln und Geld alles kaufen können. Wissen Sie was?« Sie wedelte mit dem Scheck vor seiner Nase herum. »Stecken Sie sich Ihre Dollars sonst wo hin!« Sie zerriss das Papier vor den Augen aller Anwesenden in kleine Fetzen und warf sie mit einer theatralischen Handbewegung in die Luft. »Mich können Sie jedenfalls nicht kaufen. Guten Tag, Mr. Fuller!«
Ein Johlen und Pfeifen setzte in dem Geschäft ein, einige Kunden applaudierten, viele lachten oder grinsten. Jesse hatte gepokert – und haushoch verloren. Die Niederlage war bitter. Er wusste, dass er nur einen Hauch vom Sieg entfernt gewesen war. Wenn ihm nur dieser verdammte Penner nicht dazwischengefunkt hätte … Stattdessen hatte die Kleine ihn gedemütigt. Ihn. Jesse Fuller. Und obendrein vor allen Leuten! Wenn sie glaubte, dass damit das letzte Wort gesprochen war, irrte sie sich gewaltig.
»Das wird Ihnen noch leidtun«, sagte er frostig und verließ mit erhobenem Haupt das Geschäft.